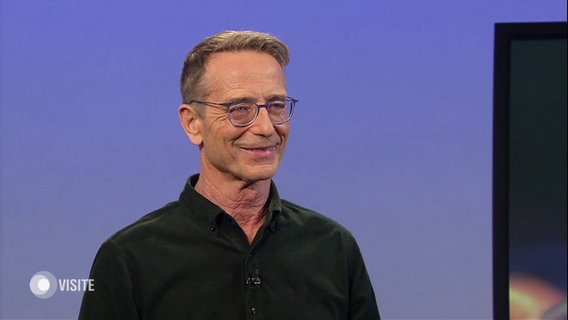Morbus Crohn: Symptome, Diagnose, Behandlung
Morbus Crohn ist eine entzündliche Darmerkrankung, die im gesamten Verdauungstrakt auftreten kann. Was sind die Symptome? Welche Diagnose-Verfahren gibt es? Welche Behandlung und Medikamente helfen?
Am häufigsten tritt Morbus Crohn zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr erstmals auf. Die Symptome sind nicht immer leicht zuzuordnen. Aphthen im Mund, Durchfälle, Unterbauchschmerzen oder Fisteln am After - Morbus Crohn löst vielfältige Beschwerden aus. Im Unterschied zur Colitis ulcerosa, einer weiteren chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED), handelt es sich bei Morbus Crohn um eine Entzündung der gesamten Darmwand - nicht nur der Darmschleimhaut. Außerdem kann Morbus Crohn im gesamten Verdauungstrakt vom Mund bis zum After und an mehreren voneinander unabhängigen Stellen auftreten. So wechseln sich gesunde und erkrankte Darmabschnitte ab. Am häufigsten betroffen ist der letzte Abschnitt des Dünndarms im Übergang zum Dickdarm. Die genaue Ursache der Erkrankung ist bisher nicht geklärt.
Symptome von Morbus Crohn: Nicht nur Durchfall
Erste Anzeichen bei Morbus Crohn können sein:
- Aphthen im Mund (kleine Geschwüre)
- Fisteln (Verbindungsgänge zwischen Organen oder vom Körperinneren nach außen), häufig zum Beispiel am After .
- chronischer Durchfall
- krampfartige Schmerzen, meist im rechten Unterbauch
- im Rahmen der Erkrankung kann es auch zur Bildung von Abszessen, tumorartigen Geschwüren und Darmverengungen (Stenosen) kommen
Deutlich häufiger als bei der Colitis Ulcerosa treten bei Morbus Crohn auch Symptome außerhalb des Verdauungs-Trakts auf. Diese können sein:
- Gelenkentzündungen (zum Beispiel an Becken, Knie- oder Sprunggelenken)
- entzündliche Hautveränderungen (zum Beispiel Entzündung des Unterhautfettgewebes)
- Augenentzündungen
- Entzündung von Leber und Gallengängen (Primär sklerosierende Cholangitis)
Je nachdem welcher Abschnitt des Verdauungstraktes von der Entzündung betroffen ist, kann es auch zur Störung der Nährstoffaufnahme kommen. Folgen davon können sein:
- Anämie
- Schlappheit und Müdigkeit
- Gewichtsverlust
- Wachstumsstörungen
- Osteoporose
- Störungen von Leber- und Gallenfunktion
- Harnsteine
Ursachen für Morbus Crohn
Welche Ursachen zu Morbus Crohn führen, ist nicht abschließend geklärt. Faktoren wie Genetik, Umwelt, Ernährung, körpereigene Abwehr und das Darmmikrobiom spielen eine große Rolle. Sicher ist, dass Rauchen das Risiko und den Verlauf bei Morbus Crohn nachhaltig negativ beeinflusst. Circa die Hälfte der Morbus-Crohn-Patienten hat eine Mutation in einem bestimmten Gen, dem NOD2/CARD15-Gen. Es ist wichtig für die Immunzellen in der Darmschleimhaut. Können sie aufgrund eines Gendefekts Krankheitserreger nicht mehr vollständig beseitigen, können die Erreger in die Darmwand eindringen. Das löst eine überschießende Immunantwort aus und kann zu einer chronischen Entzündung führen, so die Vermutung.
Erwiesen ist, dass Morbus Crohn in einigen Familien gehäuft vorkommt - und in Industrienationen häufiger als in Entwicklungsländern. Als mögliche Gründe dafür werden ungesunde Ernährung, übertriebene Hygiene und Umwelteinflüsse genannt. Depressive Verstimmungen, Ängste und als chronischer Stress empfundene Situationen erhöhen das Risiko für erneute Schübe.
Diagnose von Morbus Crohn: Blutwerte, Ultraschall und Darmspiegelung
Die Diagnose von Morbus Crohn setzt eine gründliche Anamnese voraus. Der Arzt - am besten ein Facharzt für Gastroenterologie - tastet den Bauch auf entzündungsbedingte Widerstände oder Druckschmerz ab. Eine Stuhlprobe wird auf erhöhte Entzündungswerte (Calprotectin), das Blut auf den Entzündungsmarker C-reaktives Protein (CRP) und das Vorkommen eines bestimmten Antikörpers (ASCA) untersucht. Ebenso kann im Blut ein eventuell bereits vorliegender Nährstoffmangel nachgewiesen werden.
Ein Ultraschall des Unterbauchs klärt darüber auf, ob die Darmwände entzündungsbedingt verdickt sind. Bei einer Darmspiegelung wird das Organ anschließend von innen untersucht. Dabei werden auch Gewebeproben entnommen. Auch eine Magenspiegelung oder Magnet-Resonanz-Tomografie mit Kontrastmittel (MRT nach Sellink) können erforderlich sein, um Morbus Crohn zu diagnostizieren.
Colitis indeterminata: Wenn die Diagnose unklar bleibt
Trotz aller diagnostischen Möglichkeiten kann die Unterscheidung zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Schwierigkeiten bereiten. Ist nur die Dickdarmschleimhaut entzündet und das Untersuchungsergebnis nicht eindeutig, spricht man von einer Colitis indeterminata, also von einer (noch) nicht festlegbaren Entzündung der Dickdarmschleimhaut. Dies betrifft knapp unter zehn Prozent der CED, bei Kindern und Jugendlichen sogar fast jeden fünften Fall. Manchmal klärt sich die Diagnose im weiteren Verlauf. Aber selbst wenn die entzündliche Erkrankung nicht eindeutig zu bestimmen ist, lässt sie sich behandeln - entsprechend dem Befallsmuster häufig nach den medikamentösen Standards für Colitis ulcerosa sowie mit einer speziell angepassten Ernährung.
Morbus Crohn richtig behandeln
Die Behandlung von Morbus Crohn hängt davon ab, wie aktiv die Erkrankung gerade ist und wie schwer sie ausfällt - das heißt, welche Teile des Verdauungstrakts betroffen sind und ob es zum Beispiel auch Entzündungen an anderen Stellen im Körper gibt. Man unterscheidet dabei zwischen der Therapie eines akuten Schubs und der sogenannten Erhaltungstherapie während der Ruhephase der Erkrankung. Neben Allgemeinmaßnahmen kommen vor allem entzündungshemmende und immunmodulatorische Medikamente zum Einsatz. Im Verlauf können auch Operationen notwendig werden.
Nikotinkarenz und parenterale Ernährung
Sowohl aktives als auch passives Rauchen führt bei Morbus Crohn zu einem komplikationsreicheren Krankheitsverlauf, schlechterem Ansprechen auf Therapien und einem erhöhten Risiko für Operationen. Betroffene sollten also dringend aufhören zu rauchen.
Bei Kindern ohne Komplikationen, wie Strikturen oder Fisteln, und einem nur niedrigen bis mittleren Risiko für einen schweren Verlauf ist die exklusive enterale Ernährung das Mittel der ersten Wahl. Dabei wird für sechs bis acht Wochen eine spezielle Trinknahrung eingenommen, die sowohl laktose- als auch glutenfrei ist. Sie enthält leicht resorbierbare Fette und antientzündliche Substanzen. Das kann zum Rückgang der Symptome führen.
Medikamente bei akutem Schub: Steroide und Immunsuppressiva
Bei einem leichten Krankheits-Schub kann eine symptomatische Therapie gegen Schmerzen, Durchfall oder Krämpfe helfen. Bei schweren Schüben ist dagegen der Einsatz von Medikamenten nötig, die das Immunsystem unterdrücken und Entzündungen bekämpfen. Dazu zählen Steroide (Budesonid, Prednisolon) sowie weitere Medikamente (Mesazalin, Biologika wie TNF-α-Blocker).
Erhaltungstherapie: Adalimumab, Infliximab, Vedolizumab und Co.
Um die Erkrankung auch auf Dauer in Schach zu halten und damit ein weiteres Ausbreiten möglichst zu verhindern, greift man heute vor allem auf sogenannte Biologika zurück. Dabei handelt es sich um moderne Antikörper, die das Immunsystem gezielt unterdrücken. Sie müssen als Infusion oder als Spritzen unter die Haut injiziert werden. Bei Morbus Crohn häufig eingesetzt werden:
- Infliximab, Adalimumab (Antikörper gegen TNF-α)
- Ustekinumab, Risankizumab (Antikörper gegen Interleukine)
- Vedolizumab (Antikörper gegen Integrine)
Außerdem ist seit 2023 ein spezielles Medikament zugelassen, das die Weiterleitung von Entzündungssignalen verhindert, ein sogenannter JAK-Inhibitor (Upadacitinib) . Er kann in Tablettenform eingenommen werden. Auch andere, bereits länger bekannte immunsuppressive Wirkstoffe wie Azathioprin und Methotrexat können helfen. All diese Medikamente wirken, indem sie an bestimmten Stellen das körpereigene Immunsystem drosseln. Dadurch kann es als Nebenwirkung zum Beispiel zu Infektanfälligkeit kommen.
Versagt die medikamentöse Therapie oder es kommt zu Komplikationen, kann eine Operation nötig werden, zum Beispiel um Stenosen zu weiten, Fisteln zu verschließen und um Abszesse oder erkrankte Darmpartien zu entfernen.
Richtige Ernährung bei Morbus Crohn ist entscheidend
In beschwerdefreien Zeiten (Remissionsphase) hilft eine antientzündliche Ernährung, das Darmimmunsystem zu stärken. Eine leichte Vollkost mit ausreichend (aber nicht zu viel) Ballaststoffen und Probiotika kann die Barrierefunktion der Darmschleimhaut unterstützen und den nächsten Krankheitsschub hinauszögern. In der Akutphase dagegen sind Ballaststoffe zu meiden. Häufig werden nur wenige milde Nahrungsmittel vertragen.
Morbus-Crohn-Patienten leiden häufiger unter Nährstoffmangel durch die Veränderungen in der Darmwand. Umso wichtiger ist eine gezielte Zusammensetzung der Nahrung.
Begleitend: Psychotherapie kann helfen
Morbus Crohn stellt für viele Betroffene außerdem eine seelische Belastung dar, die sich wiederum negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken kann. Psychosoziale und psychotherapeutische Unterstützung finden Patienten in Schulungsprogrammen zur Krankheitsbewältigung oder in der Begegnung mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe. Bei schwereren psychischen Begleiterscheinungen wie Depressionen ist eine Psychotherapie anzuraten.
Experte aus dem Beitrag