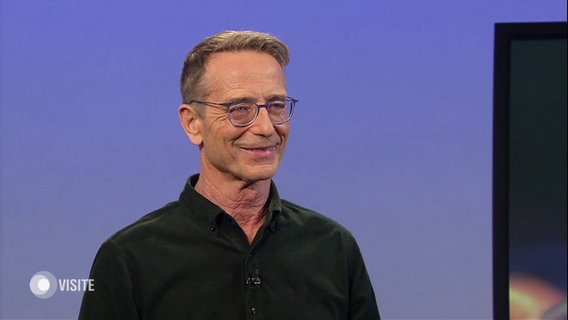Bluthochdruck: Symptome, Ursachen und Behandlung
Chronischer Bluthochdruck macht kaum Beschwerden, steigert aber das Risiko für lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es wird empfohlen, die Blutdruckwerte regelmäßig zu kontrollieren.
Beim Bluthochdruck, der arteriellen Hypertonie, ist der Druck in den Gefäßen, die das Blut vom Herzen zu den Organen leiten, chronisch erhöht. In Deutschland leidet mehr als jeder Vierte an arterieller Hypertonie, hat also dauerhaft einen Blutdruck von 140/90 mmHg oder höher. Zwanzig Prozent der Betroffenen wissen nichts von ihrer Erkrankung. Dabei kann man selbst sehr viel tun, um den Druck zu senken.
Bluthochdruck kann gefährlich sein
Chronischer Bluthochdruck birgt viele Gefahren: Nach dem Rauchen ist er der größte Risikofaktor für eine lebensverkürzende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Bluthochdruck schadet langfristig den Gefäßen, und damit auch dem Gehirn, dem Herzen und den Nieren. Mögliche Folgen: Durchblutungsstörungen am Herzen (Koronare Herzerkrankung, Herzinfarkt), in den Beinen (Schaufensterkrankheit) oder der Netzhaut am Auge, dann droht Erblindung. Etwa die Hälfte aller Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn hoher Blutdruck rechtzeitig entdeckt und behandelt würde. Herzmuskelverdickung, Herzschwäche und Nierenversagen gehen ebenfalls häufig auf das Konto des stillen Killers Bluthochdruck. Und sogar bei der Entstehung von Demenzerkrankungen kann der Hochdruck eine Rolle spielen.
Symptome bei Bluthochdruck
Bluthochdruck bleibt oft lange unbemerkt, denn es gibt - zumindest anfangs - keine typischen Symptome. Viele erhalten daher die Diagnose erst, wenn im Körper bereits nicht wiedergutzumachende Folgeschäden entstanden sind. Expertinnen und Experten raten deshalb dazu, dass jeder Mensch seinen Blutdruck regelmäßig checken und seine Werte kennen sollte.
Anzeichen für Bluthochdruck können sein:
- morgendlicher Kopfschmerz, der bei Höherlagerung des Kopfes abnimmt
- innere Unruhe, aufbrausendes Verhalten
- Schwindel, Übelkeit, Ohrensausen
- Nasenbluten
- Abgeschlagenheit
- Schlaflosigkeit
Bei stark erhöhtem Blutdruck können Brustengegefühl (Angina pectoris), Luftnot und Sehstörungen auftreten.
Diagnose: Welche Werte sind normal?
Optimal sollte der Blutdruck bei 120/70 mmHg oder darunter liegen. Der obere Wert steht dabei für den systolischen Blutdruck, wenn das Herz mit Druck Blut in die Adern pumpt. Der untere Wert zeigt den Druck an, der zwischen zwei Herzschlägen im Blutgefäß bestehen bleibt (diastolischer Blutdruck).
Werden in der Arztpraxis mehrfach Werte ab 140/90 mmHg gemessen, liegt per Definition die Erkrankung Hypertonie vor, also Bluthochdruck. Dann wird eine Therapie auch mit Tabletten empfohlen. Neu ist nach der kardiologischen Leitlinie von 2024 die Definition des Bereiches zwischen "optimal" und "krankhaft": bereits bei Werten über 120 (systolisch) beziehungsweise über 70 (diastolisch) beginnt die Kategorie "Erhöhter Blutdruck". Dann ist verstärkte Aufmerksamkeit gefragt und es sollte beim Arzt oder der Ärztin geprüft werden, ob weitere Risikofaktoren für Herz-Kreislaufkrankheiten vorliegen wie Arteriosklerose, Herzschwäche, koronare Herzerkrankung, Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 und Familiäre Hypercholesterinämie. Je nach Risiko kann es sinnvoll sein, den Druck mit Lebensstiländerung und gegebenenfalls sogar schon mit Medikamenten zu senken.
Einzelne Blutdruckwerte haben allerdings nur begrenzte Aussagekraft. Dass sich der Blutdruck im Tagesverlauf bei körperlicher und psychischer Belastung den Anforderungen anpasst und steigt, ist natürlich und sinnvoll. Besonders aussagekräftig ist die mehrfache Selbstmessung zu Hause sowie eine 24-Stunden-Messung. Bei beiden Methoden werden Mittelwerte betrachtet und die Diagnose Hypertonie bei Tagesmittelwerten ab 135/85 mmHg gestellt.
Blutdruck selber messen: in Ruhe und mehrfach
Der Blutdruck hat immer einen oberen (systolischen) und einen unteren (diastolischen) Wert. Für die Selbstmessung des Ruheblutdrucks zu Hause gelten die Empfehlungen der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie.
Messung morgens und abends, bei regelmäßigem Puls:
- Vor der Messung fünf Minuten angelehnt ruhig sitzen.
- Manschette auf Herzhöhe platzieren.
- Zwei Messungen im Abstand von ein bis zwei Minuten durchführen.
- Das Ergebnis jeder Messung notieren, pro Messtag also vier Blutdruckwerte dokumentieren.
- Eine Woche lang täglich messen.
Die Deutsche Hochdruckliga empfiehlt außerdem, 30 Minuten vor der Messung nicht zu essen oder zu rauchen, kein Kaffee oder Sport. Während und zwischen den Messungen sollte nicht gesprochen werden. Ein Messtagebuch kann bei der Dokumentation helfen. Auf Basis dieser Werte wird in der Arztpraxis ein Mittelwert gebildet, der für die Diagnose und die Therapieüberwachung bei Bluthochdruck relevant ist.
Wichtige weitere Untersuchungen
Steht die Diagnose Bluthochdruck fest, sollte insbesondere bei jungen Patienten oder sehr hohen Werten nach einer möglichen Grundkrankheit als Ursache gesucht werden (Sekundäre Hypertonie). Lässt sich die ausschließen, steht die Diagnose: primäre (essentielle) Hypertonie.
Der Arzt oder die Ärztin ermittelt dann das Herz-Kreislauf-Risiko des Patienten, indem er oder sie nach den Lebensumständen fragt, Blut und Urin untersuchen lässt. Wenn mehrere Risikofaktoren für Herz und Kreislauf vorliegen, wie ein zusätzlicher wie Diabetes oder hohe Blutfettwerte, muss der Blutdruck besonders sorgfältig gesenkt werden und die individuellen Zielwerte für die Therapie werden strenger sein.
Um eventuelle Netzhautschäden zu erkennen, kann eine Spiegelung des Augenhintergrunds sinnvoll sein. Ein EKG und ein Ultraschall des Herzens geben Aufschluss über mögliche Folgeschäden am Herzen.
Therapie bei Bluthochdruck: Gewohnheiten ändern!
Gegen Bluthochdruck lässt sich eine ganze Menge selber tun: Rauchstopp, Bewegung, richtige Ernährung und Entspannung sind die natürliche Basis jeder Blutdrucktherapie. Pro zehn Kilogramm Gewichtsabnahme sinkt der Blutdruck um etwa 12/8 mmHg. Insbesondere das Bauchfett muss weg. Ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxen bieten eine umfassende Begleitung. Während Blutdruckpatienten früher ausschließlich zu moderatem Ausdauersport geraten wurde, gehört heute unter bestimmten Voraussetzungen auch moderates Krafttraining auf den Trainingsplan. Insbesondere isometrische Übungen scheinen laut einer englischen Studie besonders wirksam gegen Hochdruck. Der Besuch einer Herzschule oder die Anmeldung in einer Herzsportgruppe kann helfen, gemeinsam mit anderen die Lebensgewohnheiten positiv zu verändern.
Bewegung hilft, Stress abzubauen. Sinnvoll sind auch Entspannungsübungen wie autogenes Training, Atemübungen oder progressive Muskelentspannung.
Mit richtiger Ernährung den Blutdruck senken
Falsche Ernährung ist ein Hauptgrund für Bluthochdruck. Übergewicht, insbesondere Bauchfett erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme. Zur gesunden Ernährung gehören sehr viel Gemüse, ausreichend Obst und Fisch. Es sollte genügend Kalium in der Nahrung sein - dagegen sollte die Zufuhr von Natriumchlorid (Kochsalz) reduziert werden. Überraschende Mengen Salz stecken in Brot, Brötchen und Fertigmahlzeiten. Von Säften oder Softdrinks lieber auf Wasser und Kräutertees umstellen, zudem wenig Alkohol trinken.
Medikamentöse Therapie
Neben der Lebensstilanpassung als Basistherapie kommen bei Werten über 140/90 mmHg in der Regel auch Medikamente zum Einsatz. Schon am Beginn sollte eine Kombination aus zwei oder drei niedrig dosierten Wirkstoffen verordnet werden. Damit kann der Bluthochdruck über verschiedene Mechanismen im Körper gleichzeitig bekämpft werden und das Risiko für Nebenwirkungen sinkt. Die vier wichtigsten Wirkstoffgruppen gegen Bluthochdruck sind:
- Sartane (AT-1 Rezeptor- Antagonisten), zum Beispiel Candesartan, Losartan
- ACE-Hemmer, etwa Enalapril, Ramipril
- Diuretika ("Wassertabletten"), zum Beispiel Thiazide oder ähnliche Entwässerungsmittel
- Calciumkanalblocker, etwa Dihydropyridin
Weitere Medikamente gegen Bluthochdruck
- Betablocker: Betablocker werden empfohlen, wenn gleichzeitig Herzerkrankungen bestehen, zum Beispiel Herzschwäche, koronare Herzerkrankung oder Herzrhythmusstörungen
- Alpha-Blocker
- Alpha-2-Agonisten
- Aldosteron-Rezeptor-Blocker
Entscheidend ist die regelmäßige Einnahme. Dabei ist es nach einer großen Studie aus 2022 egal, ob die Tabletten morgens oder abends genommen werden. Der Zeitpunkt sollte so gewählt werden, dass die Einnahme nicht vergessen wird, also immer beim Zubettgehen oder immer zum Frühstück. Außerdem sollte mindestens einmal im Jahr in der Praxis geprüft werden, ob die Medikation noch passt und den Druck ausreichend senkt.
Bluthochdruck nachts besonders gefährlich
Normalerweise sinkt der Blutdruck in der Nacht, er sollte im Schlaf um 10 bis 15 Prozent niedriger sein als am Tag. Bleibt eine solche Absenkung aus ("Non-Dipping") oder steigt der Blutdruck nachts sogar an, kann das für Betroffene gravierende Folgen haben. Weil ihr Herz dauerhaft überlastet wird, ist das Risiko für Organschäden und Herz-Kreislauferkrankungen besonders hoch - das zeigen mehrere internationale Studien, zum Beispiel aus den Jahren 2018 und 2020.
Anzeichen für nächtlichen Bluthochdruck können Schlafstörungen, Herzrasen in der Nacht, Nachtschweiß oder Kopfschmerzen am Morgen sein. Bestätigen lässt sich der Verdacht nur mittels Langzeitmessung. Über einen Zeitraum von 24 Stunden werden die Blutdruckwerte dabei regelmäßig aufgezeichnet - tagsüber alle 15 Minuten, nachts alle 30 Minuten. Eine aktuelle Untersuchungmit knapp 60.000 Teilnehmenden betont, dass diese Langzeitwerte für alle Blutdruckpatientinnen und –patienten wichtig sind, um das individuelle Risiko für Folgekrankheiten zu ermitteln und entsprechend zu behandeln.
Ursachen für nächtlichen Bluthochdruck
Dass der Blutdruck in der Nacht zu hoch ist, kann unterschiedliche Ursachen haben. Häufig ist er auf eine Hormonstörung oder eine Nierenerkrankung zurückzuführen. Auch ein Schlaf-Apnoe-Syndrom, Panikattacken oder Angsterkrankungen können verantwortlich sein. Wenn die zugrunde liegende Erkrankung behandelt wird, sinkt auch der Blutdruck. Manchmal liegt es aber auch an nicht richtig oder gar nicht eingenommenen Blutdruckmedikamenten, wenn der Druck nachts nicht runtergeht.
Sekundäre Hypertonie - wenn andere Erkrankungen den Druck hochtreiben
Steigt der Blutdruck infolge einer anderen Grunderkrankung, spricht man von einer sekundären Hypertonie. Bei Weitem die häufigste Form des sekundären Bluthochdrucks entsteht durch krankhafte Zellveränderungen in der Nebenniere: Schätzungsweise fünf Prozent aller Blutdruck-Patienten leiden an Hyperaldosteronismus, einer Hormonstörung, auch bekannt als Conn-Syndrom. Diese Grunderkrankung ist behandelbar, wird aber selten entdeckt. Insbesondere wenn Bluthochdruck schon im Alter unter 50 Jahren auftritt, kein Übergewicht oder Diabetes vorliegen und Blutdruckmittel wie ACE-Hemmer nicht wirken, sollte auf das Conn-Syndrom getestet werden. Therapeutisch wird dann beispielsweise der Wirkstoff Spironolacton verschieben, ein sogenannter Aldosteron-Antagonist. Manchmal kommt auch eine operative Entfernung der veränderten Zellen der Nebennieren infrage.
Weitere Ursachen für sekundären Bluthochdruck sind Erkrankungen der Gefäße (etwa angeborene Fehlbildungen der Hauptschlagader), endokrinologische Probleme wie die Überproduktion von Kortisol oder Adrenalin oder das Schlaf-Apnoe-Syndrom.
Salzreiche Ernährung und Bewegungsmangel als Ursachen für Hypertonie
In neun von zehn Fällen ist die Ursache des Bluthochdrucks allerdings unser moderner Lebensstil. Die arterielle Hypertonie zählt zu den wichtigsten Zivilisationskrankheiten. Übergewicht, mangelnde Bewegung, Alkohol, Rauchen, schlechte Ernährungsgewohnheiten mit hohem Kochsalzkonsum wirken sich negativ aus, insbesondere bei Menschen die salzsensitiv sind. Aber auch beruflicher oder privater Stress spielen eine wichtige Rolle.
Ursachen von Bluthochdruck bei Frauen
Bluthochdruck ist nach neueren Forschungsergebnissen geschlechtersensibel zu betrachten, denn Frauen starten mit einem niedrigeren Ausgangswert als Männer. Ein wichtiger Faktor sind die Hormone: So kann der Blutdruck unter Einnahme der "Pille" steigen. Jede zehnte Frau hat während der Schwangerschaft vorübergehend Bluthochdruck - ein Alarmzeichen dafür, dass in späteren Jahren Bluthochdruck entstehen kann.
Nicht selten tritt Bluthochdruck erst nach den Wechseljahren auf: Vor den Wechseljahren, also bis etwa zum 50. Lebensjahr, schützt das körpereigene Östrogen die Gefäße und Frauen haben zumeist einen niedrigeren Blutdruck als gleichaltrige Männer. Denn das Östrogen wirkt auch an den Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, und macht sie weich. Dadurch entspannen sich die Blutgefäße, was den Blutdruck senkt. Während der Wechseljahre, wenn der Östrogenspiegel sinkt, lässt die Schutzwirkung nach. In der Lebensphase danach ist der Östrogenspiegel so niedrig, dass keine Schutzwirkung mehr gegeben ist. Bei vielen Frauen steigt der Blutdruck dann stark, in ähnliche Höhen wie bei Männern.
Expertin und Experte aus dem Beitrag