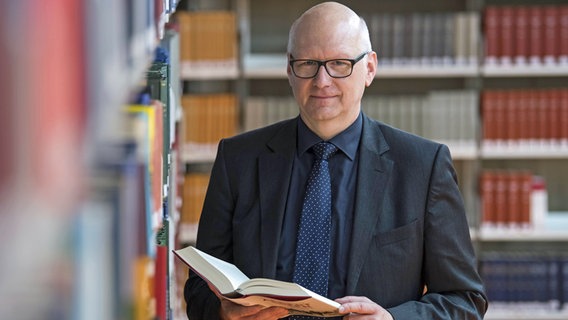Ihre Meinung zählt
NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Gedenkstunde im Bundestag zum Kriegsende
Der Bundestag hat an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Bundespräsident Steinmeier hob in seiner Rede die deutsche Verantwortung hervor. Es seien Deutsche gewesen, die den verbrecherischen Krieg entfesselt, ganz Europa in den Abgrund gerissen und das Menschheitsverbrechen der Schoah begangen hätten. Daran müsse am achten Mai erinnert werden. Steinmeier sagte zudem, auch heute noch gelte der tiefe Dank unserer Gesellschaft den alliierten Soldaten und den europäischen Widerstandsbewegungen. Sie hätten das NS-Regime unter großen Opfern bezwungen.
Link zu dieser MeldungVerfassungsschutz gibt Stillhaltezusage zu AfD ab
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Bewertung der AfD als gesichert rechtsextremistisch ausgesetzt. Im Rechtsstreit mit der Partei gab der Inlandsgeheimdienst eine sogenannte Stillhaltezusage ab. Damit darf der Verfassungsschutz die Partei vorerst auch nicht als gesichert rechtsextremistische Bestrebung beobachten, sondern lediglich als Verdachtsfall. Die Stillhaltezusage gilt solange, bis es eine Gerichtsentscheidung gibt. Die AfD hatte gegen die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch geklagt.
Link zu dieser MeldungBundespolizei verstärkt Grenzkontrollen
Die Bundespolizei in Niedersachsen hat ihre Kräfte für Grenzkontrollen aufgestockt. Wie ein Sprecher mitteilte, wird die deutsch-niederländische Grenze bereits schärfer überwacht. Grundlage sei eine Weisung des Bundesinnenministeriums. Auch aus anderen Bundesländern kamen entsprechende Meldungen. Der neue Bundesinnenminister Dobrindt hatte angekündigt, in bestimmten Fällen auch Asylsuchende an der Grenze zurückweisen zu lassen.
Link zu dieser MeldungPapstwahl: Keine Einigung bei dritter Abstimmung
Im Vatikan haben sich die Kardinäle noch nicht auf einen neuen Papst geeinigt. Auch nach dem zweiten und dem dritten Wahlgang stieg über der Sixtinischen Kapelle schwarzer Rauch auf. Für die Wahl eines neuen Papstes müssen sich die Kardinäle mit Zwei-Drittel-Mehrheit auf einen Kandidaten einigen. Heute sind noch zwei weitere Wahlgänge geplant. Der einflussreiche Kardinal Re äußerte die Hoffnung, dass schon am Abend weißer Rauch aufsteigt - das wäre das Zeichen für eine erfolgreiche Wahl.
Link zu dieser MeldungIndien greift offenbar pakistanische Flugabwehr an
Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist weiter eskaliert. Indien griff nach eigenen Angaben mehrere pakistanische Flugabwehrsysteme an, unter anderem eines in der Millionenstadt Lahore. Es handele sich um eine Reaktion auf den Versuch Pakistans, militärische Ziele im Norden und Westen Indiens mit Drohnen und Raketen zu treffen. Gestern hatte Indien nach Angriffen auf Ziele in Pakistan noch betont, man habe keine Einrichtungen des Militärs im Visier gehabt. Das hat sich jetzt geändert.
Link zu dieser MeldungKiew beklagt russische Verstöße gegen Waffenruhe
Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, die von Moskau ausgerufene Waffenruhe nicht einzuhalten. Außenminister Sybiha erklärte, die russischen Streitkräfte griffen weiterhin an der gesamten Front an. In den ersten zwölf Stunden habe man schon mehr als 700 Verstöße registriert. Das russische Verteidigungsministerium wies die Darstellung zurück. Es würden derzeit keine Raketen-, Artillerie- oder Drohnenangriffe ausgeführt. Die Ukraine habe ihre Kampfhandlungen aber nicht eingestellt, darauf müsse Russland reagieren.
Link zu dieser MeldungAutobauer bekommen mehr Zeit für EU-Klimavorgaben
Die europäischen Autobauer erhalten mehr Zeit, um die Klimavorgaben der EU einzuhalten. Das Europaparlament in Straßburg stimmte für eine entsprechende Lockerung. Demnach drohen den Fahrzeugherstellern keine Strafen, wenn sie die CO2-Grenzwerte in einem bestimmten Jahr nicht einhalten. Ausschlaggebend ist vielmehr der Durchschnittswert aus einem Zeitraum von drei Jahren. Formell müssen die Mitgliedsländer die Entscheidung noch billigen, sie hatten sich prinzipiell aber schon für die Lockerung der CO2-Vorgaben ausgesprochen.
Link zu dieser MeldungEU-Parlament macht Weg für mehr Wolf-Abschüsse frei
In der Europäischen Union sollen Wölfe künftig leichter abgeschossen werden können. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament stimmte dafür, den Status von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken. Die Änderung muss jetzt noch von den Mitgliedsländern abgesegnet werden, das gilt aber als wahrscheinlich. Viele EU-Staaten wollen Wölfe vermehrt abschießen, um ihre Weidetiere zu schützen. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, eine Änderung auf EU-Ebene unverzüglich in deutsches Recht zu übernehmen.
Link zu dieser MeldungDas Wetter in Norddeutschland
Heiter und trocken bei 13 bis 19 Grad. Heute Nacht häufig klar, in Vorpommern gebietsweise Regen, Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Morgen Sonne und Wolken, meist trocken, in Vorpommern kann es etwas regnen. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Sonnabend wechselnd wolkig und gebietsweise Regen bei 12 bis 21 Grad. Am Sonntag viel Sonne bei 13 bis 22 Grad.
Link zu dieser Meldung