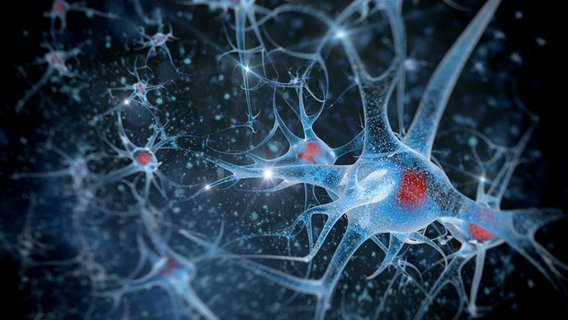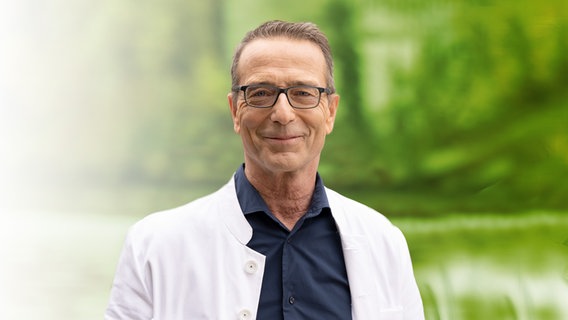Multiple Sklerose: Symptome, Diagnose, Therapie
Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, die in Schüben verläuft. Wenn Medikamente nicht wirken, kann eine Transplantation von Stammzellen helfen. Doch die Krankenkassen übernehmen die Therapie nur selten - eine Studie dazu wurde jetzt abgebrochen.
Multiple Sklerose (MS) wird auch die "Krankheit mit den 1.000 Gesichtern" genannt. Sie kann so unterschiedlich verlaufen, dass sich allgemeingültige Aussagen nur bedingt treffen lassen. In Deutschland sind mindestens 130.000 Menschen von dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung des Nervensystems betroffen, Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer. Die meisten Betroffenen erhalten die Diagnose MS im frühen Erwachsenenalter.
Ursachen für die Autoimmunerkrankung noch ungeklärt
Bei der Multiplen Sklerose greifen fehlgeleitete Immunzellen die Nerven an - das führt zu Entzündungen und Schmerzen. Die Ursachen für die Fehlsteuerung konnten bislang nicht eindeutig geklärt werden. Forschungsergebnisse deuten an, dass es eine Verbindung zwischen der Zusammensetzung der Darmflora und Erkrankungen des Gehirns gibt - "Darm-Hirn-Achse" genannt. Forscher gehen davon aus, dass zentraler Auslöser eine zunächst harmlos erscheinende Virusinfektion im Kindes- oder Jugendalter ist, die die Aktivität des Immunsystems stört.
MS ist nicht ansteckend. Sie ist auch keine Erbkrankheit im klassischen Sinn, auch wenn sie familiär gehäuft auftreten kann.
Unterschiedliche Störungen als erste Symptome für MS
Prägnante Anzeichen einer Multiplen Sklerose sind neurologische Störungen, und zwar stunden- bis tagelange Ausfallerscheinungen in unterschiedlichen Körperregionen. Einzeln oder in Kombination können folgende Symptome auftreten:
- Sehstörungen (Doppelbilder)
- Beinschmerzen
- Lähmungen
- Blasen- und Darmstörungen
- Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen
- Sprechstörungen
- Kribbeln und andere Sensibilitätsstörungen
- chronische Erschöpfung (Fatigue)
- sexuelle Störungen
Anfangs verschwinden die Störungen wieder oder es bleiben nur geringe Beschwerden zurück. Mit der Zeit kommen dann neue hinzu, die teils dauerhaft sind. Typisch für den Verlauf von MS: Der Schweregrad der Symptome nimmt mit dem Krankheitsverlauf zu, einige Störungen treten jedoch nur vorübergehend auf. Man spricht dabei von Schüben.
Diagnose mit MRT, Lumbalpunktion und Bluttest
MS ist aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsbilder auch für erfahrene Ärztinnen und Ärzte häufig schwer zu diagnostizieren.
Zunächst steht eine sorgfältige Erhebung der Krankheitsgeschichte an, die Anamnese. Klassischerweise folgt dann eine neurologische Untersuchung von Bewegungsapparat, Koordination, Gleichgewicht und Sinnesorganen. Weiter werden im Wege der Kernspintomografie (MRT) Bilder des Gehirns und Rückenmarks erstellt. Eine sogenannte Lumbalpunktion (die Entnahme von Nervenwasser mit einer Hohlnadel aus dem Rückenmark in Höhe der Lendenwirbelsäule) gibt Aufschluss über Entzündungszellen und bestimmte verdächtige Eiweißkörper. Ein Bluttest kann zwar MS nicht nachweisen, ist aber dennoch wichtig, um andere Krankheiten mit ähnlichen Symptomen auszuschließen.
Das klinische Erscheinungsbild ist mit dem bisherigen Krankheitsverlauf abzugleichen, das neurologische Untersuchungsergebnis und die Befunde aus den Zusatzuntersuchungen sind dann in einer Gesamtschau zu betrachten. Gemäß den sogenannten McDonald-Kriterien kann die Diagnose MS unter Umständen bereits nach dem ersten Schub als gesichert gelten.
Immunsystem stärken durch Ernährung
MS ist bislang nicht heil-, aber behandelbar. Es geht darum, den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen und die Lebensqualität weitestmöglich zu erhalten. Mit der Ernährung können MS-Betroffene versuchen, ihre Immunabwehr zu stärken und das Entzündungsgeschehen zu minimieren. Die Ernährung sollte deshalb vor allem aus Gemüse, hochwertigen Ölen, Nüssen und Samen bestehen. Positiv wirken sich insbesondere die entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren aus. Kohlenhydrate (etwa Brot, Nudeln, Zuckerhaltiges) sind dagegen zu meiden.
Ein weiterer Ansatz ist, für mehr gute Darmbakterien zu sorgen: und zwar mit Pro- und Präbiotika. Denn aus ballaststoffreichen Lebensmitteln stellen Darmbakterien wertvolle kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat und Propionat her. Sie werden zur Reparatur der Nervenzellen gebraucht.
Laut neueren Studien kann Propionsäure das Immunsystem stärken. Propionsalz gibt es als Nahrungsergänzungsmittel.
Medikamente zur Entzündungshemmung
Bei akuten Schüben erhalten Patienten hochdosierte Entzündungshemmer, meist Steroidhormone (Kortikosteroide). Immunstimulierende Interferone sowie Immunsuppressiva - also Medikamente, die die Immunabwehr dämpfen -, werden zur sogenannten Basis- und Eskalationsbehandlung verschrieben. Sie sollen das Fortschreiten dieser chronischen Krankheit aufhalten.
Begleitende Behandlungsansätze für Multiple Sklerose
Hinzu kommen physio- und ergotherapeutische Maßnahmen, logopädische Hilfe und - ganz wichtig - psychotherapeutische Unterstützung. Akupunktur oder anthroposophische Heilmethoden (wie etwa künstlerische Therapie, Wickel und Auflagen) können die Therapie ergänzen. Sie sollten unbedingt mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.
Stammzellentransplantation für schwerste Fälle
Wenn Medikamente kaum oder gar nicht wirken und die MS rasch und aggressiv voranschreitet, kann aus eigenen Stammzellen ein neues, gesundes Immunsystem entstehen. Durch ein Medikament wandern die Stammzellen aus dem Knochenmark in die Blutbahn und werden mit einer Art Blutwäsche entnommen. Aus diesen Vorläuferzellen können später gesunde Immunzellen entstehen, die das Nervensystem nicht mehr angreifen. Mit einer hoch dosierten Chemotherapie wird das kranke Immunsystem zerstört. Das kann lebensgefährlich sein, denn der Patient hat für etwa zehn Tage keine weißen Blutkörperchen mehr. Da höchste Infektionsgefahr besteht, muss er diese Zeit auf der Isolationsstation verbringen. Dann bekommt er die eigenen, zuvor entnommenen Stammzellen zurück. Die sollen im Knochenmark anwachsen und das frische Immunsystem aufbauen.
Stammzellentherapie: Keine Kostenübernahme trotz hoher Wirksamkeit
Die Stammzellentransplantation wirkt stärker als Medikamente, mit denen sie verglichen wurde. Eine aussagekräftige Studie hat gezeigt: Mit den Stammzellen schritt die MS nur in drei von 52 Fällen voran, in der Medikamentengruppe bei 30 von 50. Bei vielen Transplantierten gab es bis heute keine MS-Schübe mehr - teilweise schon zehn Jahre lang.
Eine weitere Studie wurde in Deutschland begonnen, um eine Kassenzulassung - und damit die Kostenübernahme durch die Krankenkassen - zu erlangen. Obwohl sich bei vielen Teilnehmern zeigte, dass die Stammzelltransplantation ein wirksamen Verfahren ist, um das Immunsystem zu beeinflussen und die vorher nicht behandelbare MS zu kontrollieren, lehnen die Kassen eine Kostenübernahme weiterhin ab.
Die Studie musste aus finanziellen Gründen abgebrochen werden. Der Abbruch bedeutet für die Betroffenen, dass sie mit ihrer Krankenkasse kämpfen müssen, um die Kosten genehmigt zu bekommen. In der Regel verweigern die Krankenkassen die Kostenübernahme einer Stammzelltherapie. Mittlerweile ist es hierzulande möglich die Stammzelltherapie selbst zu zahlen, oder Betroffene müssen die Behandlung im Ausland durchführen lassen - Kosten: 45.000 bis 50.000 Euro.
Expertinnen und Experten zum Thema
Schlagwörter zu diesem Artikel
Ernährung