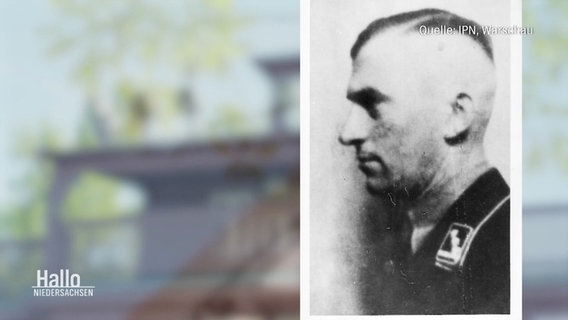NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Papst-Wahl: Glückwünsche für Leo XIV
Papst Leo XIV. hat aus aller Welt Glückwünsche zu seiner Wahl erhalten. In Peru, wo er länger als Missionar und Bischof gewirkt hat, sprach Präsidentin Boluarte von einem historischen Moment. UN-Generalsekretär Guterres betonte, als Kirchenmann habe sich Robert Prevost immer für Frieden und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Auch die katholische Kirche in Deutschland reagierte positiv. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Bätzing nannte ihn eine "hervorragende Wahl". Heute Vormittag feiert Leo XIV seine erste große Messe als neuer Papst.
Link zu dieser MeldungZoll-Konflikt: Merz spricht mit Trump
Bundeskanzler Merz hat zum ersten Mal mit US-Präsident Trump telefoniert. Laut einem Regierungssprecher ging es um die Ukraine und die Zölle gegen deutsche und europäische Unternehmen. Bei beiden Themen soll es eine enge Zusammenarbeit geben, hieß es aus Berlin. Heute ist Merz zu Antrittsbesuchen in Brüssel. Er trifft die Spitzen von EU und Nato.
Link zu dieser MeldungGedenken: Russland feiert Kriegsende
Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen findet in Moskau heute die traditionelle Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Nazi-Deutschland statt. Zu diesem Anlass werden Tausende Soldaten über den Roten Platz marschieren, begleitet von Panzern und Kampfjets. Auf der Gästeliste stehen führende Politiker befreundeter Staaten, darunter der chinesische Präsident Xi, das brasilianische Staatsoberhaupt da Silva und der slowakische Ministerpräsident Fico als einziger Vertreter eines EU-Staats. Kreml-Chef Putin hatte anlässlich der Feierlichkeiten einseitig eine dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg verkündet. Kiew wirft Russland aber vor, sich nicht daran zu halten.
Link zu dieser MeldungGaza: Neuer US-Plan für Hilfslieferung
Eine private Stiftung will die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen neu organisieren. Die "Gaza Humanitarian Foundation" hat vier Verteilzentren angekündigt, über die mehr als eine Million Palästinener mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt werden sollen. Private Sicherheitsleute werden den Plänen zufolge die Routen und Verteilzentren absichern. Seit mehr als zwei Monaten blockiert Israel alle Hilfslieferungen für die Palästinenser.
Link zu dieser MeldungParteitag: Die Linke will weiter wachsen
Die Linke will nach ihrem unerwartet guten Abschneiden bei der Bundestagswahl ihren künftigen Kurs abstecken. Zum Bundesparteitag heute und morgen in Chemnitz werden knapp 570 Delegierte erwartet. Am ersten Tag sind Reden der Parteivorsitzenden Schwerdtner, von Fraktionschefin Reichinnek und von Bundestagsvizepräsident Ramelow geplant. Die Linke hatte noch im Herbst Umfragewerte von nur etwa drei Prozent. Bei der Bundestagswahl im Februar erreichte sie dann fast neun Prozent und verdoppelte innerhalb weniger Monate ihre Mitgliederzahl auf mehr als 110.000.
Link zu dieser MeldungHamburg: Hafengeburstag und Aufstiegspartys
Hamburg feiert ab heute wieder Hafengeburtstag. Los geht es heute mit einem Gottesdienst im Michel und der Einlaufparade um 13 Uhr. Bis Sonntag rechnet die Stadt mit mehr als einer Million Besuchern. Als Geburtsstunde des Hafens gilt der 7. Mai 1189, damals soll Kaiser Friedrich Barbarossa den zollfreien Handel über die Elbe erlaubt haben. Voll wird es in Hamburg aber nicht nur rund um den Hafen: Beim HSV stehen vermutlich die Aufstiegsfeiern fürs Männer- und Frauenteam an, in der City ist eine große Fahrraddemo geplant, außerdem werden Tausende zu einer Kundgebung gegen die AfD erwartet.
Link zu dieser MeldungKultur: Filmpreis-Verleihung in Berlin
In Berlin wird am Abend der Deutsche Filmpreis verliehen. Zu der Gala im Theater am Potsdamer Platz werden etwa 1.700 Gäste erwartet. Größte Chancen auf eine der begehrten Lolas hat "September 5" von Regisseur Tim Fehlbaum. Der Thriller über das Olympia-Attentat von 1972 in München ist gleich mehrfach für den Deutschen Filmpreis nominiert. Im vergangenen Jahr ging die Goldene Lola für den besten Spielfilm an das Drama "Sterben" von Matthias Glasner.
Link zu dieser MeldungFußball: Zweimal England im EL-Finale
In der Fußball Europa League steht fest, wer im Finale steht: Manchester United und Tottenham Hotspur. Tottenham gewann gestern mit 2:0 bei FK Bodö/Glimt in Norwegen und Manchester United mit 4:1 bei Athletic Bilbao.
Link zu dieser MeldungDas Wetter: Viel Sonne im Norden
Das Wetter in Norddeutschland: Der Tag wird freundlich mit viel Sonne, in Vorpommern auch mal bewölkt. 14 Grad an den Küsten, 17 an der Seenplatte und bis 20 Grad in Hannover. Auch morgen viel Sonne. Nur im Nordosten dichtere Wolken, bei 13 bis 21 Grad. Sonntag und Montag bleibt das Wetter stabil: sonnig und trocken und es wird täglich etwas wärmer.
Link zu dieser Meldung