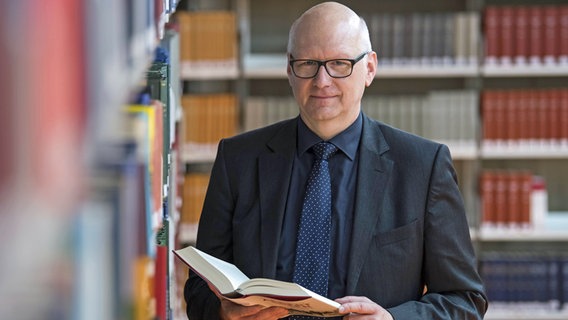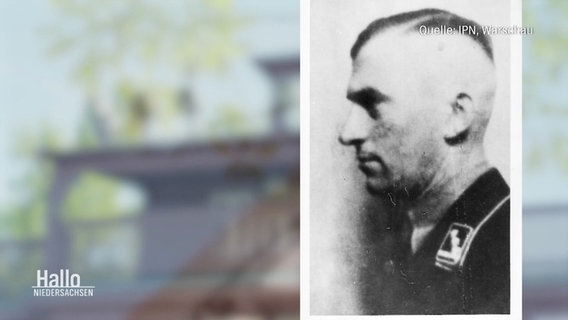NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Glückwünsche für Papst Leo XIV.
Papst Leo XIV. hat aus aller Welt Glückwünsche zu seiner Wahl erhalten. US-Präsident Trump nannte es eine Freude und eine große Ehre für die USA. Er freue sich auf ein Treffen mit dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche; Leo XIV. stammt aus Chicago. In Peru, wo er länger als Missionar und Bischof gewirkt hat, sprach Präsidentin Boluarte von einem historischen Moment. Bundeskanzler Merz betonte, in Deutschland blickten die Menschen mit Zuversicht und positiver Erwartung auf die Amtszeit. Russlands Präsident Putin setzt darauf, den konstruktiven Dialog zwischen seinem Land und dem Vatikan fortzusetzen.
Link zu dieser MeldungMerz und Trump wollen Handelsstreit "rasch beilegen"
Zwei Tage nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Merz ein erstes Gespräch mit US-Präsident Trump geführt. Beide seien sich dabei einig gewesen, die Handelsstreitigkeiten rasch beilegen zu wollen, teilte die Bundesregierung nach dem etwa 30-minütigen Telefonat mit. Sie hätten zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Beendigung des Ukraine-Kriegs vereinbart, so Regierungssprecher Kornelius. Nach seinen Worten haben Merz und Trump einen engen Austausch vereinbart und wechselseitige Besuche in den USA und in Deutschland angekündigt.
Link zu dieser MeldungEU-Außenministertreffen in Lwiw
Der neue Außenminister Wadephul ist in die Ukraine gereist. Anlass für seinen ersten Besuch dort ist ein informelles Treffen der EU-Außenminister heute in Lwiw. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte die gemeinsame Reise beim Treffen der Ministerinnen und Minister in Warschau angekündigt. Dabei stellte sie Kiew eine Milliarde Euro Unterstützung für die Verteidigungsindustrie in Aussicht. In Lwiw wollen die EU-Vertreter ihre Zustimmung für ein Sondertribunal geben, um Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen.
Link zu dieser MeldungBundespräsident zum Weltkriegsgedenken: Kein Schlussstrich
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Bundespräsident Steinmeier davor gewarnt, einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen. Bei einer Gedenkveranstaltung im Bundestag sagte Steinmeier, der 8. Mai gehöre zum Kern der gesamtdeutschen Identität. Und die Geschichte sei ein kostbarer Erfahrungsschatz. Die Deutschen wüssten, wohin aggressiver Nationalismus und die Verachtung demokratischer Institutionen führten. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht zu Ende gegangen.
Link zu dieser MeldungRegierung: Kein nationaler Notstand
Die Bundesregierung hat die Botschafter der Nachbarstaaten darüber informiert, dass an den Grenzen strenger kontrolliert wird. Dabei habe man darauf hingewiesen, dass die Bundesrepublik weiterhin partnerschaftlich und eng mit den Nachbarn zusammenarbeiten werde, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Hintergrund ist die Entscheidung, auch Asylbewerber in bestimmten Fällen an den deutschen Grenzen abzuweisen. Zugleich dementierte ein Regierungssprecher einen Bericht der Zeitung "Die Welt", wonach Kanzler Merz eine nationale Notlage ausrufen werde.
Link zu dieser MeldungIndien meldet Luftangriffe aus Pakistan
Indien hat am Abend erneut Luftangriffe auf den indisch kontrollierten Teil von Kaschmir und den Bundesstaat Punjab nahe der Grenze gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi berichtet von pakistanischen Raketen- und Drohnenattacken, die abgewehrt werden konnten; Verletzte habe es nicht gegeben. Pakistan wies die Vorwürfe zurück. Aus dem Außenministerium hieß es, Indien habe haltlose und unverantwortliche Behauptungen verbreitet. Als Auslöser der jüngsten Eskalation zwischen den beiden Atommächten gilt ein Terroranschlag vom 22. April in der Grenzregion Kaschmir.
Link zu dieser MeldungEU-Parlament macht Weg für mehr Wolf-Abschüsse frei
In der Europäischen Union sollen Wölfe künftig leichter abgeschossen werden können. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament stimmte dafür, den Status von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken. Die Änderung muss jetzt noch von den Mitgliedsländern abgesegnet werden, das gilt aber als wahrscheinlich. Viele EU-Staaten wollen Wölfe vermehrt abschießen, um ihre Weidetiere zu schützen. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, eine Änderung auf EU-Ebene unverzüglich in deutsches Recht zu übernehmen.
Link zu dieser MeldungIn Hamburg beginnt der 836. Hafengeburtstag
Heute Vbeginnt rund um die Hamburger Landungsbrücken das dreitägige Volksfest zum 836. Hafengeburtstag. Schon die Einlaufparade um 13 Uhr wird viele Zuschauer an die Elbe locken. Insgesamt werden bis Sonntag mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet. Zum Programm gehören neben Schiffsbesichtigungen, Konzerten und einem Familienfest auch das traditionelle Schlepperballett und morgen Abend ein großes Feuerwerk. Das ist ein Kritikpunkt des Naturschutzbundes, der ein nachhaltiges Konzept bei der Großveranstaltung vermisst.
Link zu dieser MeldungDas Wetter in Norddeutschland
Häufig klar, in Vorpommern etwas Regen. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tage meist trocken, in Vorpommern kann es regnen. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Sonnabend wechselnd wolkig und gebietsweise Regen bei 12 bis 21 Grad. Am Sonntag viel Sonne bei 13 bis 22 Grad.
Link zu dieser Meldung