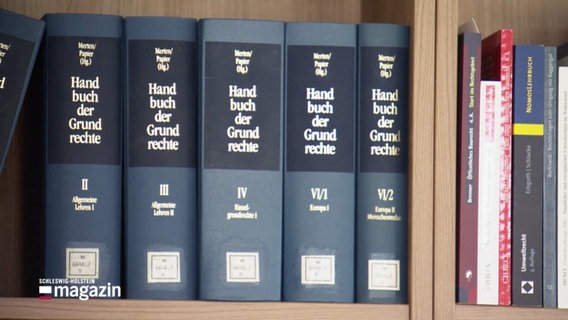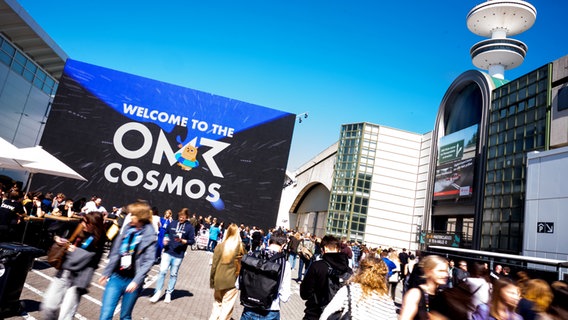NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Scholz mit Großem Zapfenstreich verabschiedet
Bundeskanzler Scholz ist mit einem Großen Zapfenstreich aus seinem Amt verabschiedet worden. Der SPD-Politiker rief dabei zum Zusammenhalt unter Demokraten auf. Es sei in diesen Zeiten keineswegs normal, dass sich ein Wechsel so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollziehe, wie man das in diesen Tagen hier in Deutschland erlebe. Der Musikkorps der Bundeswehr spielte den Beatles-Klassiker „In My Life“, einen Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach sowie das Lied „Respect“ von Aretha Franklin. Zu dem rund einstündigen Zeremoniell im Verteidigungsministerium kamen auch Bundespräsident Steinmeier, Verteidigungsminister Pistorius und andere hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft.
Link zu dieser MeldungSpahn wird neuer Fraktionschef der Union
Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn ist mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion gewählt worden. Das gaben CDU und CSU am späten Nachmittag bekannt. Der 44-Jährige folgt in diesem Amt auf Parteichef Merz, der morgen zum Bundeskanzler gewählt werden soll. Auch die SPD will ihren Fraktionsvorsitz neu besetzen: Nachfolger des zukünftigen Vize-Kanzlers und Finanzministers Klingbeil wird nach Angaben der Fraktion SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Gewählt werden soll er am Mittwoch.
Link zu dieser MeldungUnion und SPD besiegeln Koalitionsvertrag
Einen Tag vor der geplanten Regierungsübernahme haben CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Die Parteivorsitzenden setzten in Berlin ihre Unterschriften unter die Vereinbarung mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland". Am Dienstag soll CDU-Chef Merz im Bundestag zum Kanzler der neuen schwarz-roten Regierung gewählt werden. Obwohl das Polster der schwarz-roten Koalition zur erforderlichen «Kanzlermehrheit» von 316 Stimmen mit zwölf Stimmen recht dünn ist, gilt die Zustimmung als so gut wie sicher.
Link zu dieser MeldungIsrael attackiert Ziele im Jemen
Als Reaktion auf den Raketenangriff in der Nähe des Flughafens von Tel Aviv hat Israels Militär Stellungen der Huthi im Jemen angegriffen. Ziel sei unter anderem der Hafen von Hudaida im Westen des Landes gewesen, so die israelische Armee. Dieser werde etwa für den Transport iranischer Waffen genutzt. Man habe Dutzende Ziele bombardiert, hieß es. Jemenitische Medien berichten von mehr als 20 Verletzten. Eine Rakete der Huthi-Miliz war Sonntag in der Nähe des Ben Gurion-Flughafens in Tel Aviv eingeschlagen. Israel hatte daraufhin massive Vergeltungsschläge angekündigt.
Link zu dieser MeldungRumänien: Regierungschef Ciolacu kündigt Rückzug an
In Rumänien will Ministerpräsident Ciolacu zurückzutreten. Auch kündigte er an, dass sich seine sozialdemokratische Partei aus der pro-westlichen Regierungskoalition zurückzieht. Damit ist die Regierung in Rumänien faktisch zerbrochen. Als Grund verwies Ciolacu auf das schwache Abschneiden ihres Kandidaten bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Durchgesetzt hatte sich der rechte Euroskeptiker Simion. Er tritt in knapp zwei Wochen in einer Stichwahl gegen einen unabhängigen Kandidaten an.
Link zu dieser MeldungAfD-Abgeordneter verlässt Partei
Die AfD verliert nach der neuen Einstufung der Partei durch den Bundesverfassungsschutz einen Bundestagsabgeordneten. Der erst bei der Wahl im Februar neu ins Parlament eingezogene Baden-Württemberger Sieghard Knodel erklärte seinen Austritt sowohl aus der Bundestagsfraktion als auch aus der AfD. In einer E-Mail schrieb Knodel, angesichts der Einstufung der Partei als gesichert rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, müsse er sein privates und geschäftliches Umfeld schützen. Er erachte den Schritt als unvermeidlich, auch wenn er ihn sehr ungern gehe.
Link zu dieser MeldungMehr politisch motivierte Straftaten in Niedersachsen
Niedersachsens Behörden haben im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert. Nach Angaben von Innenministerin Behrens stieg die Zahl auf 7.630. Das ist ein Plus von fast 50 Prozent im Vergleich zu 2023 und der höchste Wert seit zehn Jahren. Den größten Anteil machten demnach Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund aus - ihre Zahl stieg von rund 2.550 auf etwa 3.640.
Link zu dieser MeldungRendsburg: Polizei sucht nach Schüssen Zeugen
Im schleswig-holsteinischen Rendsburg sind zwei Männer angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden tagsüber in einer Klinik erschienen und hatten angegeben, an einer Bushaltestelle in Höhe der Nobiskrug-Werft attackiert worden zu sein. Mehrere Tatverdächtige seien auf der Flucht, hieß es. Die Ermittler vermuten bislang, dass die Hintergründe der Tat im persönlichen Umfeld liegen. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Link zu dieser MeldungDas Wetter in Norddeutschland
Das Wetter in Norddeutschland: Heute Nacht häufig klar, von Norden etwas Regen. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad, leichter Frost. Morgen heiter oder dichte Wolken bei 12 bis 17 Grad. Am Mittwoch und am Donnerstag mehr Sonne und weitgehend trocken bei 13 bis 18 Grad.
Link zu dieser Meldung