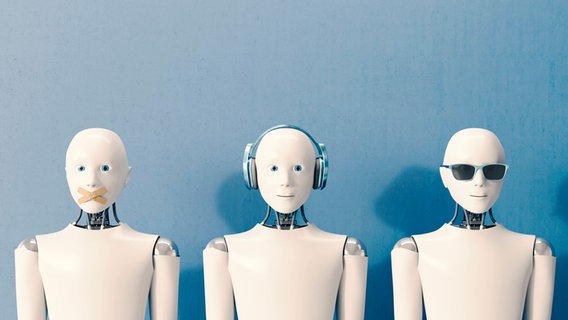Johannes Motschmann - Klavierminiaturen & Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz und Komposition: Seit Jahren forscht Johannes Motschmann in diesem spannenden Umfeld, weiß aber auch um die Probleme der Künstlichen Intelligenz in der Musik. Welche das sind, hat der Hamburger im Interview erzählt.
Beim Musikmachen verwendet der erfolgreiche Komponist und Elektronikproduzent zum Beispiel eine komponierende KI-Software, die aus wenigen Takten Skrjabin oder Rachmaninoff neue Werke in einem ähnlichen Stil entstehen lässt. Auf seinem aktuellen Album "Préludes Tableaux" verbindet Motschmann nun die Klaviermusik verschiedener Meister der Romantik und Spätromantik mit kleinen, eigenen Kompositionen. So soll "eine ganze musikalische Welt aus kleinen Formen" entstehen. Dafür nutzt der Hamburger sowohl akustische, als auch elektronische Instrumente.
Johannes Motschmann, du hast elektronische Musik, Klavier und Komposition studiert, unter anderem bei Wolfgang Rihm. Da kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich für dich auch eine prägende Persönlichkeit gewesen ist. Ich hatte mal das Glück, ihn zu Hause zu besuchen. Ich durfte über Rihm eine Homestory machen und war in seiner Villa im Wohn- oder Komponierzimmer. Ich erinnere mich, es stapelten sich bis unter die Decke Noten und Bücher, in der Mitte stand der Flügel. Wir mussten für das Gespräch den Tisch freiräumen. Bei Rihm gab es also ein richtig kreatives Chaos. Wie sieht es bei dir zu Hause aus?
Johannes Motschmann: Je nach Zustand der Komposition, ganz unterschiedlich. Tatsächlich versuche ich am Anfang, Ordnung zu schaffen. Die hält aber nicht lange vor. Ich habe immer ein Bild davon, wie ich aufgeräumt in meinem Arbeitszimmer oder unten im Bandraum sitze. Ich bin mit Synthesizern unterwegs und trete mit denen auf. Das heißt, es ist immer ein Einpacken und wieder Auspacken. Im Keller ist die ganze Elektronik eingerichtet. Da ist es mal total chaotisch, und mal sind meine Kollegen Boris und David da, und dann räumen wir auch auf. Wenn ich komponiere, dann ist es tatsächlich so, dass ich dieses Bild von mir habe, wie der angespitzte Bleistift da liegt, alles ist rechtwinklig und alle Bücher sind ganz weit weg. Nach wenigen Tagen sieht es genauso aus wie in der Wohnung von Wolfgang Rihm, also alles vollgestellt.
Wenn du zum Beispiel eine Passage instrumentierst und die ist schon da, dann hast du Ruhe. Dann kannst du dir einen Kaffee holen und dich hinsetzen. Aber wenn du das Stück komponierst, ist es genau umgekehrt. Du hast immer die Takte, die Musik oder die Frequenzen im Kopf und willst das irgendwie fassen. Du kommst mit dem Schreiben und Arbeiten gar nicht hinterher. Das heißt, da entsteht immer eine konstruktive Hektik, in der man hofft, die nicht zu verlieren. Denn oft empfindet man das, was man im Kopf hat, als Idealzustand und hofft, dass nicht zu viel davon auf dem Weg zur Realisierung verloren geht. Ich weiß gar nicht, ob man sich da auch ein bisschen selber belügt.
Du hast uns diese Miniaturen mitgebracht, total reduziert, nur du und das Klavier. Das Projekt, das du vorher gemacht hast, war viel größer. Da warst nicht nur du involviert, sondern auch viele Musikerinnen und Musiker vom Ensemble Modern. Es war ein Stück, bei dem du mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hast. "AION" heißt dieses Projekt. Man kann es in zwei Weisen lesen. Es ist sowohl das griechische Wort für Ewigkeit als auch AI für künstliche Intelligenz, also "Artificial Intelligence On". Kann man das so lesen?
Motschmann: Genau. Das war auch die allererste Idee von dem Projekt, als das Ensemble Moderne an mich herantrat. Das war übrigens genau in der Corona-Zeit. Das war das perfekte Lockdown Projekt, weil ich dafür lange brauchte. Ich hatte im SWR die Chance, gemeinsam mit Thomas Hummel, einem Musikinformatiker, eine Software zu entwickeln. Ich habe sonst keine Vorgaben bekommen. Das war ganz interessant. Ich hatte eine Carte blanche und konnte machen, was ich wollte. Ich hatte das Ensemble Modern, dieses fantastische Kollektiv von Musikerinnen und Musikern, die alles können und mit denen man alles machen kann. Das Ensemble ist unheimlich vielseitig und im Grunde eine absolute Traumkonstellation. Dazwischen schob sich die Aufgabe, eine Software zu entwickeln, mit der man diese Musik komponieren kann. Das hat Jahre gedauert.
Das heißt, du setzt künstliche Intelligenz ein, die mit dir zusammen den Kompositionsprozess übernimmt. Aber du bist nicht derjenige, der sagt, hier ist schon der fertige Computer, der macht das für mich, sondern du bist auch in diesen Teil dahinter gegangen. Du hast gesagt, gemeinsam mit Thomas Hummel, dem Musikinformatiker, baut ihr diese Software, die das macht. Hattest du dadurch das Gefühl, diese KI mehr unter Kontrolle zu haben?
Motschmann: Vor allem ist für mich jede Komposition immer eine schöpferische Situation. Das kann ich gar nicht anders denken. Das ist in mir drin. Das heißt, ich wäre nicht in der Lage, eine Software zu nutzen, bei der ich auf den Knopf drücke und dann kommt die Musik raus. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man an der Entwicklung der Software selber beteiligt ist. Das Ziel war, die Art und die Methoden, die ich beim Komponieren an den Tag lege, mit dieser Software abzubilden. Im Grunde war das ein Wechselspiel, bei dem man versucht, sich selber beizubringen, wie man schreibt und dann zu versuchen, das zu automatisieren. Damit es im weitesten Sinne eine rhythmische Komposition wird.
KI wird auch irgendwann irrational und man kann nicht mehr genau diese Ursache-Wirkung-Kette detailliert nachvollziehen. Das waren für mich große Schockmomente in der Entwicklung. Eine rhythmische Komposition ist oft etwas, wo man ein klares Ziel definiert: Wie komme ich in den Schritten zu diesem Material? Das läuft dann relativ logisch ab. Aber hier gab es immer Momente, wo man in der Lage war, sich selber zu überraschen und Dinge nicht erwartet hat. Das war auch ein bisschen gespenstisch. Ich war immer wieder durch Stipendien im SWR im Experimentalstudio, das ist ein Studio auf dem Dach, mit kleinen Bullaugen, durch die man in den Schwarzwald sehen kann. Ich war dort damals sehr abgeschirmt in der Corona-Zeit, lange bevor es ChatGPT, Udio und die ganzen musizierenden KIs gab, die es heute gibt. Insofern war es wirklich ein experimentelles Feld, indem ich mein eigenes Komponieren hinterfragt habe.
Du hast das Wort gespenstisch benutzt. Hat dir das manchmal Angst gemacht, was eure Software schon konnte, mit dem Wissen, dass ihr ihr gegeben habt?
Motschmann: Es hat mich gerührt. Ich hatte inhaltlich die Aufgabe zu klären, was mit dieser Software passieren sollte. Ich probierte sie aus und trainierte sie durch die Musik, die ich eingespielt hatte. Wie es eben so ist, wenn man solche Dinge entwickelt: Es funktioniert nicht alles sofort, sondern es gibt Dinge, die erst mal nicht überzeugend sind und es gibt auch Fehlversuche. Irgendwann gab es einen Punkt, wo ich Material eingespielt hatte und auf einmal kam da etwas zurück, was ich nicht so geplant und erwartet hatte. Eine schöne Besonderheit dieser Software ist, dass sie immer für ewig spielt. Es war der zweite Teil des Titels "AION", also Ewigkeit. Das heißt, der Zustand des Musizierens und des Entwickelns von Klängen von Musik auf dem Weg zur Komposition ist andauernd. Es hört nicht auf, bis man auf Stopp drückt. Ich habe es einfach laufen lassen. Da hatte ich die Situation, dass ich nicht wusste, was da passiert. Es waren sehr anrührende und schöne Klänge. Ich habe stundenlang zugehört. Ich habe es angelassen. Am nächsten Morgen kam der Kollege zur Arbeit und hat einen Schreck bekommen. Ich habe es extra die ganze Nacht laufen lassen, um ihm zu zeigen, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo es erstmal weiterspielt. Solange wir da nicht den Stecker ziehen, musiziert das Ding.
Da sind wir beim Problem der KI und der Musik. Denn das, was Menschen tun, ist immer zeitlich begrenzt. Es erhält auch seine Würde dadurch, dass es nicht ständig mehr Material davon gibt. Es gab schon mal so ein KI-Projekt, wo eine zehnte Sinfonie von Beethoven fertiggestellt wurde. Dann denke ich, das könnte man jetzt einmal, zehnmal oder hundertmal machen. Damit reproduziert man einfach Masse. Das führt wie in der Wirtschaft zu Inflation, das entwertet sich ab einem gewissen Punkt auch wieder. Das heißt, man muss lernen, damit umzugehen, dass man das Material mit viel Vorarbeit leicht gewinnt. Aber dann beginnt die Arbeit, weil man mit sehr viel Material auch sehr verantwortungsvoll umgehen muss. Es hat gar keinen Sinn, Leuten stundenlang KI-Musik vorzuspielen. Das interessiert auch gar keinen. Das heißt, es geht darum, etwas Einmaliges, Seltenes auch etwas, was sich schwer wiederherstellen lässt, zu extrahieren. Und nicht zu glauben, dass man in einer Fließband-Musikproduktion einen Moment von Wahrheit findet. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Es ist mir sehr wichtig, dass man immer auch die Kritik bei diesem Thema mitdenkt.
Das Gespräch führte Anna Novák.
Schlagwörter zu diesem Artikel
Klassik