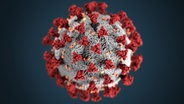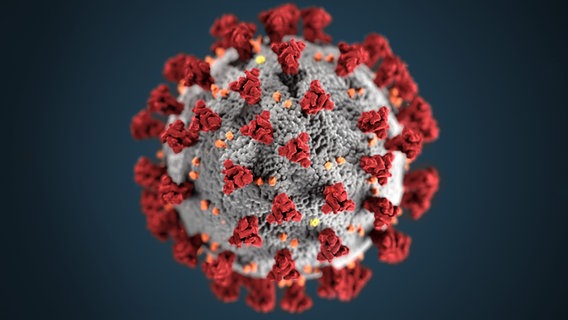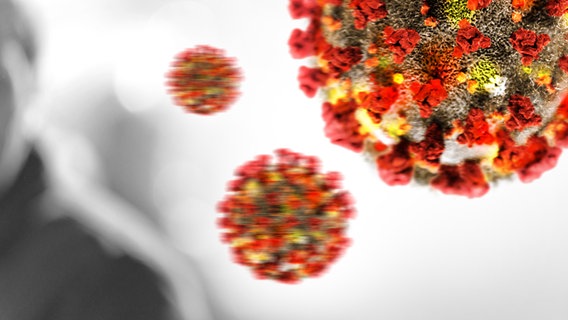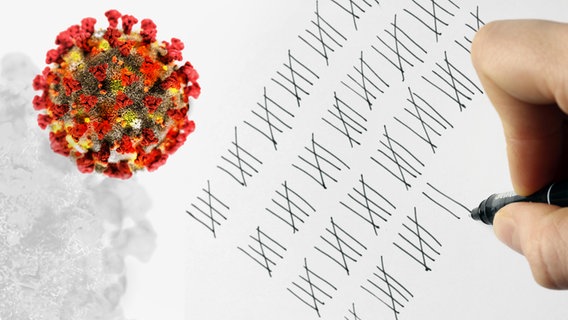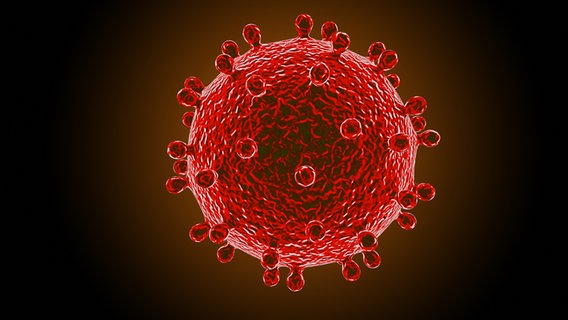Coronavirus-Update-Sonderfolge: Achtet auf die Kinder!
In der Pandemie hat die mentale und physische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen extrem gelitten. Was das bedeutet, erklären die Mediziner Ulrike Ravens-Sieberer und Daniel Vilser.
Auf den Seiten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen alle Covid-19 Trendkurven nach unten, das betrifft die Inzidenzen als auch die Hospitalisierungen und die Todesfälle. Der R-Wert liegt deutlich unter 1 und das gute Wetter sorgt für den Saisoneffekt. Trotzdem, die Pandemie ist noch nicht zu Ende, nicht nur mit Blick in die Zukunft - also auf den Herbst, sondern auch was die Gegenwart angeht. Die dreistelligen Inzidenzen treffen, wie so vieles in dieser Pandemie, besonders die Kinder und Jugendlichen.
Über Kinder und Jugendliche ist viel berichtet worden im Laufe der Pandemie, sie waren und sind Thema teilweise erbitterter politischer Debatten in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig spricht über Kinder in der Pandemie in einer Sonderfolge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update mit Ulrike Ravens-Sieberer, Forschungsdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), und Daniel Vilser, Leitender Oberarzt an der Klinik für Kinder und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Jena.
Die zentralen Themen der Folge im Überblick - per Klick direkt zur Textstelle springen
Wahrnehmung der Bedürfnisse von Kindern in der Pandemie
Daten zur psychischen Gesundheit aus der COPSY-Studie
Beeinträchtigung von Heranwachsenden durch hohe Inzidenzen
Post Covid bei Kindern und Jugendlichen: Definition, Prävalenz, Altersstruktur
Erfahrungen aus der Post-Covid-Ambulanz in Jena
Schwierigkeiten bei der Erforschung von Post Covid bei Minderjährigen
Internationale Forschungsliteratur zu Post Covid bei Kindern
Sozioökonomische Risikofaktoren für psychische Auffälligkeiten
Psychosomatische Beschwerden als Pandemiefolge
Bedeutung von Resilienz und familiärem Zusammenhalt
Ernährung und Freizeitverhalten von Minderjährigen
Symptomatik für Post Covid bei Kindern
Diagnostik von Post Covid in der Ambulanz
Dauer der Symptome und Erforschung von Mechanismen
Risikofaktoren und Verlauf der Akutinfektion
Autonomie, Selbstwirksamkeit und aktiver Infektionsschutz der Kinder
Impfempfehlung auch für jüngere Kinder?
Ausblick: Vorkehrungen für den Herbst
Psychosoziale und medizinische Versorgungslage in Deutschland
Wahrnehmung der Bedürfnisse von Kindern in der Pandemie
Korinna Hennig: Ich würde Sie eingangs um eine allgemeine Einschätzung bitten, bevor wir in Ihre jeweiligen Forschungsfelder eintauchen, wegen der Sie beide heute hier im Podcast sind. Es ist viel darüber berichtet worden, dass in anderen Ländern in der Pandemiepolitik mehr Abstriche bei den Erwachsenen gemacht wurden, zum Beispiel eine strengere Homeoffice-Quote, härtere wirtschaftliche Einschnitte, Beschränkungen im Nahverkehr und dafür im Austausch zum Beispiel die Schulen früher wieder geöffnet wurden.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie sehr sind die Bedürfnisse von Kindern im Laufe der Pandemie in Deutschland beachtet worden? Oder umgekehrt gefragt: Wie sehr sind Sie zu kurz gekommen?
Daniel Vilser: Ich habe schon das Gefühl, dass das Pandemiegeschehen am Anfang sehr auf dem Rücken der Kinder kontrolliert wurde. Das heißt, dass die Einschränkungen der Kinder dramatischer gewesen sind als die, die wir Erwachsenen zu erdulden hatten.
Hennig: Frau Ravens-Sieberer, insbesondere was die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder angeht, das ist ja Ihr Forschungsfeld. Wie haben Sie das wahrgenommen, auch im Verlauf der Zeit? Wie sehr gucken wir tatsächlich auf Kinder und Jugendliche in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ulrike Ravens-Sieberer: Ich würde auch sagen, die Bedürfnisse der Kinder wurden recht spät wahrgenommen. Das ist aber vielleicht ja auch richtig und wichtig im Rahmen einer neuen Pandemie. Denn zunächst war es ja so, dass die volle Aufmerksamkeit diesen direkten infektiologischen Auswirkungen galt. Und die indirekten Folgen, also was bewirken eigentlich die Maßnahmen, die wurden ja erst später deutlich.
Zu Anfang wurde auch viel geschaut, wie geht es eigentlich den Älteren, weil die ja unmittelbar stark bedroht waren. Da hat man glaube ich, wirklich nicht im Blick gehabt, dass auch diese Pandemiemaßnahmen tatsächlich Konsequenzen hervorrufen, die ja zu Anfang überhaupt nicht intendiert und auch nicht auf dem Schirm waren. Das kam erst später. Und das war wichtig. Also ich glaube, fast ein Jahr nach Pandemiebeginn hat die Leopoldina eine Stellungnahme herausgegeben, die sich damit beschäftigt: Was hat das eigentlich für Konsequenzen für Kinder im Bildungsbereich?
Und jetzt, dieses Jahr im Februar kam dann auch die Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung, die dann gesagt haben, jetzt muss eigentlich das Kindeswohl in der Pandemie prioritär berücksichtigt werden. Und diese Frage des Kindeswohls, die ist relativ spät aufgekommen.
Daten zur psychischen Gesundheit aus der COPSY-Studie
Hennig: Wir wollen heute auch darüber reden, was genau dieses Kindeswohl ist und inwieweit auch Infektionsschutz und psychosoziale Fürsorge miteinander zusammen hängen? Das wird manchmal getrennt und auch gegeneinander diskutiert. Sie haben die erste Welle der COPSY-Studie im Mai und Juni erhoben. Da wurden etwas mehr als 1.100 Kinder und mehr als 2.600 Eltern befragt.
Und die hat viel Beachtung in den Medien gefunden, genau aus diesen Gründen, dass man immer mehr versucht hat zu beachten, wie es den Kindern in dieser ganzen Situation geht? Das waren Zahlen, die für viele relativ erschreckend waren. Wie gut haben wir Journalisten da unsere Sache gemacht in der Berichterstattung über die Ergebnisse Ihrer Studie? Ist sie dem gerecht geworden?
Ravens-Sieberer: Vielleicht kann ich noch mal sagen: Wenn wir uns da zurückerinnern, im März 2020 hat sich innerhalb weniger Tage das Leben für ganz viele, also 13 Millionen Kinder in Deutschland ganz schlagartig verändert. Die Lebenswelten für die Kinder sind eigentlich komplett weggebrochen. Die Kitas waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen, die Spielplätze waren gesperrt. Und auch so der Kontakt zu den Freunden und Angehörigen, der war ja irgendwie nur noch über das Telefon oder soziale Medien möglich.
Die Kinder und Jugendlichen konnten ihr gewohntes Leben, auch Hobbys, Freizeitaktivitäten, Sport überhaupt nicht mehr machen. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten: Wie einschneidend ist es eigentlich wirklich für die Kinder? Vor unserer Befragung hätte ich wahrscheinlich gesagt: Na ja, man wird es vielleicht merken, aber es wird schon irgendwie kompensiert werden. Und deswegen, diese ersten Ergebnisse haben uns auch, muss ich sagen, wirklich erstaunt, dass die so deutlich waren. Und das ist dann aber von der Presse doch gut aufgenommen worden. Also in dem Moment, wo wir hier im UKE die Pressekonferenz gemacht haben, war das mediale Interesse wirklich groß und es wurde dann auch das Thema der Kinder weiterverfolgt.
Also ich muss schon sagen, dass wir das nicht so vermutet hatten. Es gab natürlich internationale Publikationen aus asiatischen Ländern mit strengeren Lockdowns, dass da eben mentale Gesundheit von Kindern schlechter wurde. Aber wir haben das für Deutschland eigentlich nicht so stark vermutet. Und das ist aber dann doch aufgegriffen worden in den Medien und auch verfolgt worden. Ich muss sagen, ich glaube, das hat auch was bewirkt.
Hennig: Wenn wir ein paar Zahlen vorwegnehmen aus dieser ersten Welle, über die wir gerade gesprochen haben. Da waren zum Beispiel doppelt so viele Kinder im Vergleich zur Vor-Pandemiezeit, die von gemindert Lebensqualität berichtet haben, vier von zehn Kindern.
Mentale Gesundheit
Jedes dritte Kind hatte Probleme mit der mentalen Gesundheit. Das Risiko für psychische Auffälligkeiten hatte sich fast verdoppelt. Das sind diese erschreckenden Zahlen, von denen ich gesprochen habe. Wie stark muss man denn überhaupt unterscheiden zwischen, ich sage mal hemdsärmelig allgemeiner, vorübergehender psychischer Belastung, die alle getroffen hat, die Kinder ganz besonders, und einer klinischen Manifestation?
Ravens-Sieberer: Vielleicht kann ich vorausschicken, dass wir natürlich diese Verschlechterung der psychischen Befindlichkeit von den Kindern deswegen beurteilen konnten, weil wir Zahlen von vor der Pandemie hatten. Das wissen wir, weil wir uns eigentlich seit mehr als 20 Jahren in großen Längenschnittstudien gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut die psychische Befindlichkeit und auch die Lebensqualität von Kindern angucken. Und zwar auch, indem wir sie selber danach und auch ihre Eltern befragen. Das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen oder mir wichtig zu sagen, weil wir immer versucht haben, den Kindern eine Stimme zu geben.
Und jetzt war es so, dass sich nach Beginn der Pandemie, wie Sie gesagt haben, die Lebensqualität der Kinder deutlich verschlechtert hatte. Vorher konnte man sagen, ungefähr 20 Prozent aller Kinder, also zwei von zehn, hatten vor der Pandemie eine eingeschränkte Lebensqualität. Und dann war es auf einmal doppelt so hoch, also vier von zehn. Das heißt im Grunde genommen, das sind verschiedene Lebensbereiche von Kindern, die dann mit einfließen. Also sie fühlten sich weniger fit und wohl, haben weniger Energie gehabt, können sich nicht gut konzentrieren, waren weniger autonom.
Aber vor allen Dingen muss man sagen, was so besonders einschränkend war, ist, dass sie die sozialen Kontakte abbrechen mussten, also dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen konnten und auch, dass sie Angst hatten, dass sie die Leistungen in der Zukunft nicht mehr erbringen können, weil ja auch die Schule geschlossen war.
Zukunftsängste
Also Zukunftsängste und die Angst, den Kontakt zu Freunden, zu den besten Freunden zu verlieren. Das waren so die Hauptsorgen. Natürlich hat sich das auch in allgemeinen psychischen Belastungen niedergeschlagen, die wir mit Screening-Instrumenten erfassen. Also wenn die psychische Gesundheit des Kindes beeinträchtigt ist, und das zeigt sich eben oft in so einer Kombination von belastenden Gefühlen, Verhaltensweisen und Beziehungen. Hier ist mir ganz wichtig zu sagen, natürlich führt nicht jede psychische Auffälligkeit zu einer psychischen Erkrankung.
Das ist das, worauf Sie angespielt haben. Also eine Belastung heißt noch nicht, dass man die Diagnose bekommt oder dass man auch daran erkrankt ist. Es heißt aber erst mal, dass das Risiko dafür steigt. Und wir sehen ja jetzt, sozusagen fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, dass die Versorgung hier von Anfragen erdrückt wird. Also dass wir im Grunde genommen immer noch nicht sagen können, alle, die belastet waren, sind erkrankt, aber es sind doch viele, wo Erklärungsbedarf besteht.
Hennig: Wir wollen im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen differenzieren, wer genau ist da wie betroffen, wer eher nicht und wer ist gut durch die Pandemie gekommen oder kommt gut dadurch. Und auch den Versorgungsaspekt möchte ich gern später noch mal ansprechen. Trotzdem noch eine Begriffsklärung, Sie haben von psychischer Belastung zur Unterscheidung gesprochen. Und in der COPSY-Studie gibt es auch den Begriff psychische Auffälligkeit. Was genau meint das in diesem Spektrum zwischen einem höheren Risiko und einer tatsächlichen Erkrankung?
Ravens-Sieberer: Wir haben ja sozusagen die Belastung mit Screening-Instrumenten erfasst. Das ist ein Screening-Instrument für psychische Auffälligkeit. Das heißt, man erreicht da einen bestimmten Wert und wenn der über einem bestimmten Niveau ist, dann würde man sagen, innerhalb dieses Screening-Instrumentes ist ein bestimmtes Kind auffällig. Das heißt, es sollte bei Fachleuten abgeklärt werden, ob hier eventuell eine Diagnose besteht oder ob die Auffälligkeit so ist, dass man intervenieren müsste.
Hennig: Bevor wir dann in Ihre beiden Gebiete einsteigen, würde ich gerne noch mal im Großen und Ganzen schauen: Wenn Sie alle drei Wellen in den Blick nehmen, wir haben ja jetzt ein paar Zahlen aus der ersten Befragungswelle angesprochen. Die letzte war jetzt im vergangenen Winter. Wie hat sich die psychische Situation der Kinder im Pandemieverlauf entwickelt? Also wir hatten ja am Anfang den ersten Lockdown - ein Begriff, den ich im internationalen Vergleich mit aller Vorsicht verwende - aber mit den härtesten Einschnitten.
Dann gab es eine Befragungswelle im Herbst 2020, als es diesen "Lockdown light", also diesen immer wieder verlängerten, aber nicht so heftigen Lockdown gab. Und in der letzten Welle hatte sich ja auch von den Grundvoraussetzungen schon wieder einiges verändert. Wie hat sich da die Situation der Kinder entwickelt? Wie ging es ihnen? Ist es besser geworden?
Ravens-Sieberer: Wir können sagen, dass wir insgesamt so die ersten 18 Monate überblicken, mit drei Befragungswellen. Und man kann grundsätzlich sagen, dass zum Schluss, also in der dritten Welle, die Belastungen durch die Pandemie etwas zurückgegangen sind. Also nach einer langen Phase der Belastung zu Beginn und dann auch noch mal bei der zweiten Befragung einer weiteren Verschlechterung hatte sich dann im Herbst die Lebensqualität der Kinder und auch die psychische Gesundheit etwas verbessert.
Auch psychische Auffälligkeiten wie Angst und Depression waren leicht zurückgegangen. Aber man muss sagen, trotz dieser leichten Verbesserungen innerhalb der Pandemie waren die seelischen Belastungen immer noch höher als vor der Pandemie. Es war immer noch mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Und es waren auch immer noch psychosomatische Stresssymptome vorhanden. Die hatten sozusagen gar nicht abgenommen, sondern eher noch zugenommen.
Änderungen über den Pandemieverlauf
Man kann also sagen, über den Verlauf der Zeit ist die seelische Belastung während der Pandemie etwas zurückgegangen, aber sie hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und liegt immer noch deutlich über den Werten von vor Corona. Und Sie haben auch schon gesagt, da waren viele Bedingungen anders. Wir haben dann versucht, uns das zu erklären. Warum ist das eigentlich so? Und natürlich war es so, dass der Alltag entspannter war und auch die Kontrolle teilweise wiedergewonnen wurde im Herbst 2021.
Also die Situation hatte sich etwas entspannt, die Inzidenzen war niedrig, die Pandemiemaßnahmen waren reduziert worden, das heißt, die Kinder konnten auch wieder in die Schule gehen. Sie konnten wieder Freunde treffen und sie konnten ihren Hobbys nachgehen. Und vermutlich war es so, dass die Pandemie selber und auch diese Veränderungen, die damit einhergegangen sind, nicht mehr so beängstigend wahrgenommen wurden wie in den ersten beiden Befragungswellen.
Beeinträchtigung von Heranwachsenden durch hohe Inzidenzen
Hennig: Zwischen den ersten beiden Befragungswellen hat es ja auch noch mal einen Anstieg gegeben, obwohl bei der zweiten Befragungswelle die Maßnahmen, zumindest die kontaktbeschränkenden Maßnahmen, nicht mehr ganz so hart waren. Wie kann man das erklären?
Ravens-Sieberer: Das stimmt. Es hat einen Anstieg gegeben, auch in der Inzidenz, aber auch in der psychischen Belastung der Kinder und Jugendlichen. Und vielleicht muss man sagen: Die erste Welle, da war alles neu, da war alles bedrohlich, die Inzidenzen waren aber nicht so hoch. Während der zweiten Befragung sind die dann gefühlt durch die Decke gegangen. Und da war es dann aber auch noch mal so, dass über härtere Maßnahmen diskutiert wurde. Also das spielt eine Rolle.
Insgesamt muss man sagen, wir haben das selber nicht so voraussehen können. Also wenn Sie mich damals gefragt haben, dann war es ja so, wir haben die erste Befragung initiiert, weil wir gedacht haben, wir müssen einfach mal gucken, wie es den Kindern geht und was die uns sagen, was sie eigentlich besonders belastet, als eigentlich hat da noch niemand über die Kinder gesprochen. Und dann haben wir gedacht: Na ja, dann machen wir doch die zweite Befragung einige Monate später, wenn die Pandemie dann eigentlich schon wieder vorbei ist. Aber dann ging es erst noch mal so richtig los, sodass es noch mal genau in diesen Zeitraum fiel. Und auch danach haben wir dann gesagt: Na ja, dann befragen wir doch wieder ein Jahr später im Herbst, wenn dann die Pandemie vorbei ist. Und da standen wir wieder am Anfang von steigenden Zahlen.
Längsschnitt
Wir hatten zwar den Sommer hinter uns, sodass im Grunde genommen aus dieser eigentlich einmalig geplanten Befragung dann ein Längsschnitt geworden ist, der auch noch weitergeht. Aber Sie können natürlich nicht immer antizipieren, wie sich die Pandemie und damit auch die Lockdown-Maßnahmen weiter dazu entwickeln. Und ich glaube, warum es mit der zweiten Befragung so anstieg, das lag auch an den Maßnahmen zur Pandemieeindämmung. Die Kontakte wurden reduziert, die Schulen wurden noch mal geschlossen und es war nicht ersichtlich, wann das aufhören würde. Das war, glaube ich, das Beängstigende.
Hennig: Herr Vilser, da sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser Diskussion, was ist denn aber eigentlich Belastung durch die Pandemie? Sind es die Maßnahmen? Sind es nur die Maßnahmen? Welche Rolle spielt das Virus für Kinder und Jugendliche selbst? Viele Kinderärzte, zumindest die sich öffentlich geäußert haben, vor allem auch Vertreter der pädiatrischen Fachgesellschaften, haben das lange Zeit mit dem Tenor getan: Das Virus selbst ist für Kinder gar nicht so gefährlich. Aber die Grundbedingungen der Pandemie beeinträchtigen sie sehr, insbesondere eben die Maßnahmen, über die Frau Ravens-Sieberer eben auch gesprochen hat.
Die Maßnahmen als solche, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen. Allerdings, in den ersten Wellen gab es eben niedrigere Inzidenzen durch die Maßnahmen, Kinder waren weniger häufig infiziert als jetzt. Mit Omikron haben wir deutlich höhere Zahlen, auch jetzt noch, und es gibt kaum bis keine Maßnahmen mehr. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt? Gilt diese Reihenfolge weiter, diese Gewichtung aus Ihrer Sicht, was die Kinder am meisten beeinträchtigt, Maßnahmen oder tatsächlich Krankheitslast, Infektionszahlen?
Vilser: Ich denke schon, dass sich das etwas verändert hat. Also ich stimme erst mal absolut zu, dass man am Anfang bei drastischen Maßnahmen für die Populationsgruppe, die eigentlich die geringsten Auswirkungen des Virus zu erdulden hatte, also direkten Auswirkungen der Infektionsfolgen, da war schon eine gewisse Diskrepanz.
Unterschied: Verlauf bei Omikron
Mittlerweile muss man sagen, auch wenn jetzt bei Omikron, das kann man schon gut sagen, die akute Infektion milder verläuft als bei Alpha, Delta und dem Wildtyp, das ist nicht nur bei Erwachsenen so, das ist auch bei Kindern so, da haben wir natürlich ein anderes Verhältnis zu Infektionszahlen und zu Maßnahmen, wenn man es so nennen möchte. Aber das, was jetzt noch aktiv ist, beschränkt sich ja im Wesentlichen auf Masketragen und gelegentliche Testung und Isolierung. Und da muss man schon sagen, mittlerweile denke ich, dass auch bei dem milderen Verlauf aufgrund dieser hohen Infektionszahlen, die das leider ein bisschen aufwiegen, im Moment eher die direkte Krankheitsfolge das ist, was eine Rolle spielt.
Hennig: Tatsächlich dann auch durch die hohen Inzidenzen. Sie kümmern sich ja um Langzeitfolgen des Virus in der Ambulanz. Was wissen Sie über die akuten Krankheitsverläufe, die dann bei Kindern und Jugendlichen auch für andere Kinder und Jugendliche sichtbar wird? Also immer mehr Kinder werden jemanden aus ihrem Freundeskreis kennen, bei dem das nicht ganz mild verlaufen ist.
Vilser: Die Definition von "mild" heißt ja erst mal: Wer nicht im Krankenhaus landet, der hat eine milde Infektion. Das heißt nicht, dass man nicht zu Hause hohes Fieber haben kann und ein schweres Krankheitsgefühl. Das wird immer unterschätzt. Das ist für uns trotzdem noch eine milde Erkrankung. Wenn ich mir anschaue, womit wir uns im Krankenhaus beschäftigt im letzten Jahr und auch jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten haben, dann ist es schon das SARS-CoV-2-Virus, das uns am meisten beschäftigt hat.
Da ist einfach eine Krankheitslast durch diesen Erreger da, auch schon durch die akute Erkrankung. Trotzdem, die Erkrankung verläuft bei Kindern mild. Wir haben ganz wenige Todesfälle, die mit diesem Virus assoziiert sind, das sind unter 100. Wir haben ein kleines bisschen dieses PIMS, das pädiatrische Multisystem Inflammationssyndrom, das aber unter Omikron deutlich seltener ist, als es zum Beispiel noch unter Delta der Fall war. Und wir haben diese große Blackbox, die sich Long Covid nennt.
Hennig: Haben sich die hohen Inzidenzen unter jungen Leuten in irgendeiner Form auch in den mentalen Auswirkungen niedergeschlagen? Es gibt ja diese übliche Frage unter Erwachsenen: Na, hast du es schon gehabt oder bist du noch verschont geblieben? Spielt das eine Rolle? Was wissen wir darüber?
Ravens-Sieberer: Also wir haben natürlich auch gefragt, wie stark die Angst ist, die Erkrankung zu bekommen. Ich denke, das ist natürlich schon ein Thema, aber es ist sozusagen viel stärker bei den Kindern und Jugendlichen ausgeprägt, was die Angst vor den Maßnahmen zur Pandemie Bekämpfung betrifft. Also es ist nicht die Erkrankung selber, die sie selbst erfahren, sondern vielleicht auch eher die Sorge um die Angehörigen und vielleicht auch Oma und Opa und Eltern, dass die die Erkrankung bekommen. Das spielt schon eine Rolle.
Aber man muss schon deutlich sagen, dass eigentlich die Einschränkungen der psychischen Befindlichkeiten nicht auf die Erkrankung direkt zurückzuführen sind, sondern eigentlich mit den Maßnahmen zur Infektionsreduktion einhergehen.
Post Covid bei Kindern und Jugendlichen: Definition, Prävalenz, Altersstruktur
Hennig: Herr Vilser, Sie haben eben gesagt Blackbox Long Covid oder Post Covid bei Minderjährigen. Wir wollen versuchen, die ein bisschen aufzumachen und da reinzugucken. Es gibt eine Definition für Post Covid und Long Covid der WHO für Erwachsene, die vor allem den zeitlichen Rahmen definiert. Also Symptome müssen mindestens drei Monate nach der akuten Infektion noch anhalten oder neu aufgetreten sein. Kann man die im Großen und Ganzen auf Kinder und Jugendliche übertragen? Oder gehen Sie da anders ran?
Vilser: Nein, wir gehen da sehr ähnlich dran. Wir haben das diskutiert in einer Expertenrunde, die sich aus Konvent-Gesellschaften der DGKJ, der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin, zusammensetzte. Und wir haben uns eigentlich auf Definitionen für Deutschland geeinigt, die dem sehr nahe kommen.
Hennig: Es gibt aber auch immer noch Zweifel, die immer wieder von verschiedenen Menschen laut geäußert werden, auch von Ärzten, ob es das Post-Covid-Syndrom bei jüngeren Kindern überhaupt gibt. Ich glaube, Konsens ist, dass man das bei Teenagern auf jeden Fall messbar beobachtet. Bei unter Zwölfjährigen gibt es aber schon wieder viele Fragezeichen. Was für Erfahrungen machen Sie da in der Ambulanz? Was für Kinder kommen da zu Ihnen?
Vilser: Wir beschäftigen uns in Jena seit Anfang letzten Jahres mit dem Thema. Und zu dem Zeitpunkt waren dieselben Ärzte der Meinung, das Thema gibt es bei Kindern generell nicht. Mittlerweile gibt es Evidenz, und die Zahlen sind auch so hoch, dass man das nicht mehr negieren kann, dass das auch bei Kindern eine Rolle spielt. Und jetzt werden dieselben Diskussionen eben nach unten geschoben und es wird gesagt: Okay, dann gibt es das bei großen Kindern, aber bei kleinen eben nicht.
Dieses Schwarz-Weiß-Denken funktioniert in der Medizin nicht. Was man ganz klar sagen kann, es wird seltener, je jünger die Kinder sind. Das sehen wir bei uns. Und so liest sich auch die Literatur. Dass es das bei kleinen Kindern unter zwölf nicht gibt, das ist Quatsch. Selten ja, aber das gibt es dort genauso und muss dort auch genauso ernst genommen werden.
Hennig: Und zwar in allen Altersgruppen, bis runter zu den Säuglingen? Wie alt war Ihr jüngster Patient?
Vilser: Das kleinste Kind war neun Monate, dem wir hier letzten Endes diese Diagnose gestellt hatten. Der hatte unter der Infektion Schlafstörungen entwickelt im Sinne von, dass er Atemaussetzer hat und auch eine obstruktive Atemstörung. Das heißt, er hat nicht mehr so gut Luft bekommen. Das gibt es auch bei anderen Viren. Das ist jetzt nicht exklusiv für Covid.
Diffuse Symptomatik
Und man muss ja auch sehen, je kleiner die Kinder werden, umso schwieriger ist diese ganze diffuse Symptomatik, die zu Long Covid gehört, auch abzufragen und zu erfassen. Wie soll ein Zweijähriger sagen, er kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und hat "Brain Fog"? Wie soll man da feststellen, dass er eine Fatigue-Symptomatik hat? Das geht bei Erwachsenen viel leichter. Also, je jünger die Kinder waren, umso schwieriger ist es die Diagnose zu stellen.
Hennig: Erinnern Sie sich noch an den Moment, an dem Ihnen klar wurde, das ist wirklich auch bei jüngeren Kindern nicht so problemlos, wie das lange angenommen wurde? Zumindest in kleinerer Zahl?
Vilser: Wir haben von Anfang an Anmeldungen gehabt und Patienten, die auch kleiner waren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit so einer Altersabhängigkeit noch gar nicht intensiv beschäftigt. Wir haben nur festgestellt, es gibt es generell bei Kindern und wir müssen uns dem Thema annehmen. Und haben dann eben geschaut, wer zu uns kommt und jetzt kann man sagen, es gibt eine klare Teenager-Lastigkeit.
Prä- und postpubertär
Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie mit Prä- und Post-Pubertät zu tun hat: Wenn man postpubertär ist, ist das Risiko höher als präpubertär, was dann auch gut mit diesen elf, zwölf Jahren passt. Aber das hat sich dann erst so rausgestellt.
Erfahrungen aus der Post-Covid-Ambulanz in Jena
Hennig: Sie haben die Ambulanz im Frühjahr 2021 in Jena eröffnet. Warum war das notwendig? Warum konnte man die Patienten nicht mehr im üblichen Krankenhausbetrieb diagnostizieren und behandeln?
Vilser: Den richtigen Anstoß gab es im Herbst. Da hatten wir zwei oder drei Leistungssportler aus dem Sportgymnasium gehabt, die natürlich sehr gut von der Leistungsfähigkeit kommuniziert sind und die nach Covid einfach nicht mehr leistungsfähig gewesen sind. Und nachvollziehbar, weil das ja auch eine Klientel ist, das will Leistung bringen. Die waren dann zuerst in der Kardiologie, haben dort Untersuchungen bekommen mit EKG und Ultraschall. Und dann haben wir gesagt: "Okay, am Herzen hast du nichts, du musst wieder zum Hausarzt."
Dann hat der Hausarzt sie zur Pneumo geschickt, zu den Lungenfachärzten. Der sitzt eigentlich auf demselben Gang, zwei Türen weiter. Da waren sie dann ein paar Tage später. Dann hat er eine Lungenfunktion gemacht, hat sie sich angeschaut und gesagt: "Ich finde jetzt an der Lunge auch nicht so richtig was, geh woanders hin. Vielleicht hängt das Ganze ja mit irgendwas Rheumatologischem zusammen." Dann sind die wieder zum Kinderarzt gegangen. Und dann haben wir uns irgendwann mal auf dem Gang getroffen, nachdem diese Patienten zugenommen haben und sagten: "Ja, wir werden denen einfach nicht gerecht, wie es im Moment läuft. Wir schicken die von Pontius zu Pilatus. Wir bürden dem Kinderarzt etwas auch, was er eigentlich nicht leisten kann. Das müssen wir besser machen."
Alle Fachrichtungen in der Kinderklinik haben sich dann zusammengesetzt und haben ein Programm erarbeitet, wo jeder mal für sich recherchiert hat: Was gibt es denn für Folgen nach Covid in meinem Organgebiet? Was sollten wir uns anschauen? Und haben daraus dann ein Programm gebastelt und die Patienten strukturiert angeschaut.
Schwierigkeiten bei der Erforschung von Post Covid bei Minderjährigen
Hennig: Sie haben es eben angesprochen, wie schwierig es ist, festzustellen. Vor allem, je jünger der Patient ist. Hat jemand ein Post-Covid-Syndrom, ein Long-Covid-Syndrom. Und schon in der Forschungsliteratur zu Erwachsenen kursieren ja auch ganz verschiedene Zahlen. So langsam einigt man sich da auf eine oder zwei Größenordnungen.
Bei Kindern ist es noch mal schwieriger, überhaupt diesen kausalen Zusammenhang herzustellen, gerade wenn die Infektion ein paar Wochen oder Monate zurückliegt. Worauf würden Sie sich jetzt festlegen, ich sage mal bewusst festlegen, aber wir machen das in aller Vorsicht, was die Prävalenz angeht? Wie hoch ist der Anteil von ehemals infizierten Kindern aus der Studienliteratur, die von Post Covid oder Long Covid betroffen sind?
Vilser: Also für Erwachsene sind es diese ungefähr zehn Prozent, an denen man sich festhält. Was man ganz sicher sagen kann, es ist bei Kindern seltener. Das ist das, was man sicher sagen kann. Dann schwankt die Studienliteratur, die eine Kontrollgruppe dabei hat, die versucht, diese Lockdown-Effekte, Pandemie-Effekte rauszurechnen irgendwo zwischen 0,8 und 13 Prozent, wobei sich die meisten Studien irgendwo so um die drei Prozent einpendeln. Wenn ich mich festlegen muss auf eine Zahl, dann denke ich, dass drei Monate nach der Infektion höchstens noch ein Prozent der Kinder wirklich unter Folgen des Virus leidet.
Hennig: Das heißt, in den Wochen nach der Infektion könnten das auch mehr sein, bei denen klingt es dann aber vergleichsweise schnell wieder ab?
Vilser: Richtig. Nach vier Wochen ist die Zahl sicherlich noch etwas höher, aber auch noch mit einer sehr, sehr guten Prognose versehen, so, dass man wirklich sagen kann: "Gib dem Körper etwas Zeit, sich zu erholen, damit umzugehen. Die Chancen, dass das alles wieder normal wird, die sind sehr, sehr gut." Nach drei Monaten muss man dann sagen, wer dann wirklich noch unter Problemen leidet, der hat schon auch eine Chance, dass sich das noch ein bisschen hinzieht.
Hennig: Wenn die Altersverteilung aber so unterschiedlich ist und wir jetzt diese, meinetwegen, ein Prozent auf die Gesamtzahl der Minderjährigen in Deutschland beziehen, dann ist das in den Altersgruppen ja unterschiedlich verteilt. Das heißt, da kann man einfach so linear von ausgehen, je eher sie in der Pubertät sind, umso höher ist die Prävalenz? Also kommt es dann doch vielleicht bei zehn Prozent vor, bei acht Prozent?
Unterschied Mädchen und Jungen
Vilser: Ich denke, immer noch seltener als bei Erwachsenen. Aber ja, sicherlich haben wir, wenn man sich das Risikokollektiv der Kinder raussuchen möchte: Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren wären, sicherlich eher Richtung zehn Prozent, wobei es die eben nicht ganz erreicht.
Hennig: Mädchen sind überbetont, das haben Sie jetzt gerade schon angedeutet.
Vilser: Genau. Wie bei den Erwachsenen, da sind Frauen überbetont und das sehen wir auch, Mädchen sind überbetont.
Hennig: Es gibt mittlerweile ganz verschiedene Studien. Wir wollen hier auch im Podcast ein paar verlinken. Es gibt ziemlich gute Daten aus Dänemark. Es gibt Daten aus England, auch das wissen wir hier schon aus dem Podcast und Leute, die viel lesen. Trotzdem haben die ganz unterschiedliche Zahlen, weil die Erforschung so schwierig ist. Was würden Sie sagen, was ist das Grundproblem, das manche Studien haben? Weil sie müssen ja irgendwie einen Vergleich ziehen zu dem, was an uninfizierten Kindern an Symptomen vorkommt, also das Hintergrundrauschen.
Vilser: Das Hintergrundrauschen herauszurechnen, ist erst mal extrem schwierig. Die ersten Studien, die dazu rauskamen, haben eben Symptome gezeigt von bis zu 60 Prozent, wo eben kein Kontrollkollektiv dabei war und wo die Frage dann relativ einfach formuliert war. Also: Hast du in den letzten vier Wochen Kopfschmerzen gehabt?
Long-Covid-Fragebögen
Also nach dem Motto: Ja, okay, es ist ein Long-Covid-Symptom. Und was es eben schwierig macht, ist, mit einem Fragebogen eine Erkrankung abzufragen, zu der letzten Endes bis zu 200 Symptome beschrieben sind, die irgendwie damit zusammenhängen können. Einen Fragebogen zu konzipieren, der das so genau abfragt, dass er wirklich sagt: Okay, wie war es vor der Infektion? Wie war es danach? Wie hat sich das verändert?
Das sind Dinge, die kann man in der Anamnese, also wenn man sich mit dem Patienten unterhält, hakt man da bei jedem einzelnen Symptom nach und versucht eben rauszubekommen: Ist das was Neues? Ist es was, was vorher schon da war? Ist es etwas Relevantes? Der Fragebogen kann das in der Art nicht. Diese Schwierigkeit haben letzten Endes alle Befragungen, die dazu stattfinden. Dazu kommt noch die inhomogene Definition. Gucke ich es mir nach vier Wochen an, gucke ich es mir nach acht Wochen an, gucke ich es mir nach zwölf Wochen an. Wie lange zurückliegen dürfen die Symptome? Wir wissen, dass das bei Long Covid schwankt.
Das heißt, die Symptome kommen manchmal und gehen. Das heißt, es macht keinen Sinn zu fragen: Was hast du in den letzten drei Tagen gehabt? Da werden wir ganz viele, die wirklich schwer betroffen sind, möglicherweise nicht mit abfragen. Fragen wir über die letzten drei Monate, kriegen wir wieder viel zu viel. Und das macht es so brutal schwer.
Kontrollgruppen
Hennig: Und die Definition der Kontrollgruppen auch. Also wer ist da drin? Wie viel vorerkrankte Kinder gehören da rein? Wie lang ist der Zeitraum, über den Kontrollgruppen über Symptome berichten? Das sind wahrscheinlich auch alles Faktoren, die die Zahlen verzerren können.
Vilser: Das ist richtig. Die meisten Kontrollgruppen werden versucht zu matchen. Das heißt, dass sie wirklich zu den Infizierten passen. Oder man nimmt so große Gruppen, dass man sagt, das rechnet sich hier raus und wir haben ein normales Kollektiv. Was man mittlerweile einfach auch mitbedenken muss, wir haben jetzt so hohe Infektionszahlen, wenn ich jetzt einen Fragebogen an Kinder rausschicke, von denen ich weiß, sie hatten einen positiven PCR-Test und nehme einfach ein Schulkollektiv als Kontrollgruppe ohne in der Serologie zu gucken, ob die auch infiziert waren, das kann ich eigentlich schon nicht mehr machen.
Mittlerweile ist die Infektion so weit unter der Bevölkerung verteilt gewesen, dass ich das Kontrollkollektiv eigentlich kontrollieren muss, also wirklich beweisen muss, die hatten die Infektion nicht.
Internationale Forschungsliteratur zu Post Covid bei Kindern
Hennig: Dunkelziffer, immer ein schwieriger Faktor bei Kindern. Woher kommen denn die für Sie verlässlichsten Zahlen? Welche Studien in diesem großen Wust an Literatur leuchten für Sie am meisten ein? Ich habe es angesprochen, in Dänemark läuft die Long-Covid-Kids-Studie. In England gibt es die CLoCK-Studie. Aber es gibt auch Studien in der Schweiz und Italien.
Vilser: Die Fragebogenstudien mit den meisten Patienten kommen beide aus Dänemark, die ein ganz gutes System mit der Erfassung haben. Wer da PCR-positiv ist, der wird erfasst und kann angeschrieben werden, sodass die tatsächlich die gesamte Bevölkerung anschreiben können für solche Fragen. Das funktioniert in Dänemark sehr viel leichter, als es in Deutschland der Fall ist.
Die CLoCK-Studie aus England ist auch eine sehr große Studie mit vielen Tausend Kindern. Da sieht man, wie wichtig es ist, ein Kontrollkollektiv mitzuführen, weil letzten Endes bei über 60 Prozent der Kinder dort Symptome in den Fragebögen angegeben wurden, die mit Long Covid vereinbar wären. Aber eben genauso bei 50 Prozent der Kontrollgruppe. Man hat da auch nur die Differenz genommen und das waren die 13 Prozent, wo man sagt: "Okay, möglicherweise ist das die Zahl der Kinder, die Long Covid haben."
Auch aus Deutschland gibt es zumindest eine Studie, die man da noch erwähnen kann, die sich Krankenkassendaten von 2020 angeschaut hat. Und dort geschaut hat, wie hoch ist das Risiko, nach einer Infektion noch eine Diagnose zu bekommen, die mit Long Covid zusammenhängen könnte? Also zum Beispiel Husten oder eine Fatigue-Symptomatik? Und die haben das Risiko für die Kinder auch mit 1,3 berechnet, im Vergleich zum Kontrollkollektiv.
Hennig: Das ist eine Studie aus Dresden. Richtig?
Vilser: Genau.
Internationaler Vergleich
Hennig: Wie international vergleichbar sind solche Daten? Wir wissen ja, dass so ein Grundgesundheitszustand auch entscheidend ist bei dem, was das Virus dann mit dem Körper macht. Es wurde oft diskutiert, dass man die Daten aus den USA zum Beispiel insbesondere für Kinder nicht einfach auf die deutschen Daten legen kann.
Vilser: Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Ich glaube, dass wir von den Ländern, von denen wir gerade gesprochen haben, gerade von Dänemark, von einem ganz ähnlichen Grundgesundheitszustand ausgehen dürfen. Auch in Großbritannien ist es nicht so viel schlechter. Die eine Studie ist aus Deutschland. Das heißt, die kann man schon ganz gut hernehmen.
Vergleich USA und Deutschland
Die Daten aus den USA sind in der Tat manchmal etwas schwierig, wenn wir uns zum Beispiel das PIMS anschauen, dann hatten die in den USA ein bis zwei Prozent Todesfälle, also eine richtig relevante Sterblichkeit bei dem PIM-Syndrom. Und wir haben in Deutschland nicht einen einzigen Fall, der in Verbindung damit gestorben ist. Oder zumindest von dem wir das wissen.
Hennig: Ich würde die Zahlen gerne noch einmal ins Verhältnis setzen zu dem, was man sich darunter vorstellen kann. Also wenn man jetzt sagt, ein Prozent der infizierten Kinder entwickelt möglicherweise vorübergehend zumindest ein Post- oder Long-Covid-Syndrom, dann klingt das erst mal gar nicht so viel. Wenn man aber hohe Inzidenzen hat und das dann hochrechnet, ganz abstrakt als fiktive Rechnung, meinetwegen bei einer Inzidenz von 400, dann kommt man auf 550 potenzielle Post-Covid-Fälle pro Woche in Deutschland, oder? Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, bei fünf Millionen infizierten Kindern kommt man auf 50.000 Post-Covid-Fälle.
Vilser: Ja, wobei man sagen muss, das geht ja auch wieder weg. Ein großer Teil, das ist ja das Gute daran, hat das nicht sein Leben lang in Anführungszeichen. Wir kennen es ja erst seit zwei Jahren. Also wirklich ganz gute Langzeitergebnisse können wir ja alle nicht präsentieren. Aber wenn man davon ausgeht, dass sich fünf Millionen Kinder infiziert haben und ein Prozent davon irgendwie langanhaltende Probleme hatte, dann sind das die 50.000, die entweder unter einem Post-Covid-Syndrom litten oder aktuell leiden. Und das ist schon eine relevante Anzahl.
Hennig: Aber, das muss man auch noch dazusagen, es ist eine große Bandbreite von Symptomen, über die wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen.
Vilser: Genau, das ist wichtig, dass sie nicht alle schwerstkrank sind.
Hennig: Also nicht alle haben Chronic Fatigue und können nicht mehr zur Schule gehen. Bei Weitem nicht alle. Sondern auch einige, die vielleicht immer mal wieder müde sind oder die vielleicht auch über einen längeren Zeitraum Geruchs- und Geschmacksverlust haben.
Vilser: Richtig.
Sozioökonomische Risikofaktoren für psychische Auffälligkeiten
Hennig: Wissen wir etwas darüber, wie die Struktur der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist? Frau Ravens-Sieberer kennt das aus ihrem Zugang, ihrem Forschungszugang, dass der sozioökonomische Hintergrund eine große Rolle dafür spielt, wie sehr jemand ein Risiko hat, an Folgen der Pandemie zu leiden, aber auch an Erkrankungsfolgen in jeglicher Hinsicht. Gibt es da irgendwelche Daten zu, auch was Long und Post Covid bei Minderjährigen angeht?
Vilser: Aus meinem Wissensstand gibt es keine wirkliche Bindung an eine bestimmte sozioökonomische Struktur beim Auftreten von Long-Covid-Syndrom.
Hennig: Bei den mentalen Folgen sieht es aber anders aus.
Ravens-Sieberer: Ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Da können wir eigentlich ganz deutlich sehen, dass vor allen Dingen sozial benachteiligte Kinder die Veränderung durch die Pandemie als ganz besonders belastend erlebt haben. Das sind Kinder aus Familien, die vielleicht weniger finanzielle Ressourcen haben, die auch einen Migrationshintergrund haben können. Und vor allen Dingen, die auf beengten Raum leben.
Und wir sehen gleichzeitig auch, dass die Kinder vor allen Dingen dann besonders belastet sind, wenn sie auch vor der Pandemie schon vorbelastet waren. Und aber auch, wenn ihre Eltern unter einer psychischen Erkrankung oder einer Belastung leiden. Man kann eigentlich sagen, dass das einer der wichtigsten Risikofaktoren ist. Und für diese Kinder ist es dann auch so, das zeigt sich auch im Verlauf der Pandemie, dass die in ihrer Lebensqualität einfach mehr als doppelt so häufig eingeschränkt sind oder depressive Symptome haben und dreimal so häufig psychische Auffälligkeiten. Also das ist schon so, dass wir natürlich wissen, dass diese Kinder schon vorher auch gesundheitlich belastet waren.
Das wissen wir ja auch aus der Erwachsenenforschung, dass es da einen Zusammenhang mit dem sozialen Gradienten gibt. Aber das ist in der Pandemie einfach noch mal eklatant deutlich geworden. Kinder, die zu Hause irgendwie nicht aufgefangen werden können, die auch keine Wertschätzung erhalten und deren Sorgen und Nöte nicht gehört werden, denen geht es eben besonders schlecht. Man muss sich vorstellen, wenn jetzt alle Lebenswelten wegbrechen, dann bleiben eigentlich noch die Eltern zu Hause. Und wenn die nicht da sind, weil sie auch besonders belastet sind, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach zeitlich nicht anwesend, dann wird das zum Problem.
Hennig: Und das sind dann auch die Kinder, die am stärksten mit Problemen in der Schule zu kämpfen haben. Ist das aus der Forschung quasi deckungsgleich, also für die das Homeschooling besonders relevant war, weil ihnen die Unterstützung fehlte?
Ravens-Sieberer: Genau, weil sie zu Hause nicht aufgefangen wurden. Und weil wir ja lange darüber nicht diskutiert haben, was gibt es eigentlich für Strukturen, die wirklich flächendeckend sind, die so etwas wie fehlende Bildung auffangen können? Also die Schulen haben ihr Bestes gegeben, davon bin ich überzeugt, aber es war eben sehr unterschiedlich. Sie haben viele Schulen und Lehrer gehabt, die versucht haben, den Kontakt zu den Kindern zu halten und bei anderen hat es aus vielen Gründen nicht so gut geklappt.
Fehlende Strukturen
Aber ich glaube, wenn das so ein bisschen zufällig ist oder auch willkürlich, dann haben wir noch nicht die richtigen Strukturen etabliert. Und es geht hier da vor allen Dingen gar nicht so sehr um die Lerninhalte, fand ich immer, sondern wirklich auch darum, den Kontakt zu erhalten und die Lernmotivation. Das war wahrscheinlich in dem Raum viel wichtiger. Und da sind viele dieser Kinder, die auch sonst Risiken in sich vereinen aus dem Blick geraten und auch oft gar nicht mehr in Kontakt mit der Schule geblieben.
Hennig: Wir haben den Begriff vulnerable Gruppen vor allen Dingen für die alten Menschen in unserer Gesellschaft gelernt. Würden Sie sagen: Nein, das ist aber eigentlich auch ein Begriff, den man auf diese Gruppe von Kindern definitiv anwenden muss in Bezug auf die gesamte Pandemie, gesundheitliche, aber auch mentale und Bildungsfolgen?
Ravens-Sieberer: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch immer alle Kinder als sozusagen Vulnerabel bezeichnet, einfach weil sie in einem bestimmten Alter Entwicklungsaufgaben zu erledigen haben und sich ablösen müssen. Sie müssen Selbstwirksamkeit, sie müssen Selbstsicherheit, sie müssen Kompetenzen erlernen. Deswegen ist es generell schon eine vulnerable Phase. Aber das gilt für diese Kinder natürlich ganz besonders, einfach weil sie schlechtere Startbedingungen haben.
Psychosomatische Beschwerden als Pandemiefolge
Hennig: Sie haben in der COPSY-Studie aber nicht nur nach zum Beispiel depressiven Symptomen gefragt, nach Angst, nach "mir geht es nicht gut mit dieser Situation", ganz allgemein gesagt, sondern auch nach psychosomatischen Beschwerden. Also Kopfschmerzen und Bauchschmerzen sind so klassische Symptome bei Kindern. Welche Rolle spielen die insbesondere auch mit Blick auf die verschiedenen Gruppen von Kindern?
Ravens-Sieberer: Wir haben ja oft gesehen, dass sich psychische Belastung in körperlichen Beschwerden äußert. Dann spricht man von sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Und da haben wir auch ganz konkret nach bestimmten Befindlichkeiten gefragt. Und wir sehen natürlich, dass diese Beschwerden, so was wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, aber auch Kopf- oder Bauchschmerzen, auch Konzentrationsschwierigkeiten, also auch diese Dinge, von denen jetzt auch Herr Vilser berichtet hat, Einschlafprobleme, Schlafprobleme, Gereiztheit, dass die während der Pandemie oder sagen wir mal im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie, haben die sich fast verdoppelt. Und auch hier sind es wieder die Kinder aus niedrigen sozialen Schichten, sage ich jetzt mal etwas verallgemeinernd, die das sehr in sich vereinen.
Hennig: Ist denn aber auch denkbar, dass da in Ihren Zahlen einiges an Post-Covid-Fällen mit drinsteckt? Das ist ja genau der Bereich, wo sich jetzt was überschneidet, wie Sie es selber gerade angesprochen haben.
Ravens-Sieberer: Genau. Das habe ich eben auch gedacht, als Herr Vilser gesprochen hat. Es ist ja doch so, dass man das manchmal schlecht trennen kann. Herr Vilser, Sie haben ja schon gesagt, dass es natürlich methodische Schwierigkeiten gibt, das auch zu erfragen, aber es ist einfach schwer, Long Covid von anderen Pandemieeffekten zu trennen. Denn auch Kinder, die kein Covid hatten, zeigen viele dieser Long-Covid-Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Also die Frage ist: Ist das dann Long Covid oder sind die Kinder durch die Pandemie mental erschöpft?
Und das ist natürlich schwierig auseinanderzuhalten, weil auch wenn man sich anguckt, wer hatte denn Covid und wer hatte keins, dann sieht man, wenn man Schüler befragt, sowohl bei den seropositiven als auch bei den seronegativen Schülerinnen und Schülern diese Long-Covid-Symptome. Und das ist natürlich die Frage: Wie kann man das klug beforschen, dass man das auseinanderhalten kann? Aber was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass wir sehen, hier ist die Belastung einfach bei den Kindern groß und da müssen wir Strategien entwickeln, um die Belastung zu senken, ganz egal, was jetzt sozusagen die Ursache ist.
Hennig: Herr Vilser, Sie haben in Ihrer Ambulanz natürlich genau entwickelt, gerade weil Sie interdisziplinär arbeiten, wer da alles damit befasst ist im Falle eines Falles, da haben Sie natürlich genaue Strukturen entwickelt, um eine Diagnose zu stellen. Kommen denn viele Kinder und Jugendliche zu Ihnen nach Infektion mit psychischen, aber vielleicht auch neurologischen Symptomen, die aber dann am Ende weggeschickt werden müssen, weil man sagt: "Das ist kein Post Covid, das ist was anderes, was du hast"?
Vilser: Wegschicken tun wir keinen. Aber wir haben durchaus Anmeldungen und auch Patienten, die da sind, die wir dann am Ende anderen Krankheitsbildern zuordnen. Was Frau Ravens-Sieberer gesagt hat, ist völlig richtig, es ist sehr, sehr schwer, zwischen Post-Covid-Symptomen und den allgemeinen Belastungssymptomen durch die Pandemie zu unterscheiden. Ich versuche ehrlich gesagt, diese Trennung manchmal gar nicht mehr so hart vorzunehmen, weil wir sehen ein Kind mit Symptomen und Leidensdruck.
Unser Anspruch ist primär, erst mal eine Erkrankung auszuschließen, die das verursacht, die wir behandeln könnten. Das heißt, das ist eigentlich unser Anspruch. Wir möchten nicht eine Myokarditis übersehen. Wir möchten nicht eine Depression übersehen oder eine Lebererkrankung. Das ist der Anspruch unserer Diagnostik.
Hennig: Wegschicken hieße ja auch in dem Fall nicht nach Hause schicken, sondern sie werden gegebenenfalls woanders hin überwiesen, weil schlecht geht es ihnen allemal.
Vilser: Genau. Und das nehmen wir ernst. Egal, wo das nun herkommt. Darum geht es ein bisschen bei uns. Und das ist ein kleines bisschen das Problem der Kinder, wenn sie zu uns kommen, dass sie in der Regel seit Wochen Probleme haben und die Familien oftmals das Gefühl hatten, nicht ernst genommen worden zu sein. Und wir versuchen, für diese Kinder einen Weg zu finden, aus dem sie aus ihrer derzeitigen Problematik rauskommen. Das ist bei einigen eine psychosomatische Lösung, wo wir dann tatsächlich sagen: Okay, wahrscheinlich eher weniger Post-Covid-Syndrom, vielleicht doch eher was Psychosomatisches.
Wenn man sich überlegt, wie entstehen psychische Erkrankungen: Da gibt es Forschungsfelder, die sich sehr damit beschäftigen, ob das nicht auch ein Ungleichgewicht von Hormonen, von Transmittern ist, die dazu führt, dass solche psychischen Erkrankungen entstehen. Da beschäftigt sich zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit in Jena sehr stark mit. Ich sehe das gar nicht so als Diskrepanz Schwarz-Weiß, entweder psychosomatisch oder Virus-Folge, sondern das sind für mich sehr viele Grautöne. Und wir müssen eben den Ansatz finden, der dem Kind am besten hilft.
Hennig: Wie gut ist eigentlich in der Öffentlichkeit, in Ihrer Wahrnehmung, dieses Phänomen Psychosomatik verstanden? Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen: Aha, da bildet sich also jemand nur was ein.
Vilser: Die Frage geht auch wieder an uns beide. Ich kann mal anfangen. Ich finde, die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und dementsprechend auch von psychosomatischen Erkrankungen ist in unserer Gesellschaft leider immens. Das heißt, das wird nicht ansatzweise so ernst genommen, das sieht man ja schon an der Diskussion gerade. Also entweder hast du Long Covid oder Post-Covid-Syndrom, also ein Virus, was echt ist. Oder es ist halt was Psychosomatisches. Dann bitte reiß dich doch mal zusammen und mach wieder. Das finde ich, ist eine Katastrophe, diese Herangehensweise.
Ravens-Sieberer: Also ich möchte das unterstreichen. Und vielleicht auch noch mal, ich glaube auch, man darf es nicht gegeneinander ausspielen, ist es jetzt körperlich oder psychisch? Weil wir ja einfach wissen, dass im Grunde genommen dieser Zusammenhang zwischen Körper und Psyche so stark ist, eigentlich ist diese Trennung oft artifiziell. Bei vielen primär psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Ängsten oder Persönlichkeitsstörungen treten auch gehäuft unspezifische körperliche Symptome auf und umgekehrt. Diese Trennung in sozusagen rein psychische und rein somatische Erkrankung ist häufig nicht möglich.
Und auch deswegen schwierig, weil es auch lange verhindert hat, dass die Disziplin innerhalb der Medizin kooperieren. Das ändert sich ja jetzt, aber gerade bei den Kindern und gerade auch bei diesen unspezifischen Symptomen und der Frage, wie lange persistiert das eigentlich, ist es ja umso wichtiger, dass es interdisziplinär angeschaut wird. Wie Herr Vilser sehr richtig sagt, wir müssen gucken, dass wir organische Schäden auf Dauer natürlich bei den Kindern ausschließen. Aber auch, wenn wir sehen, das sind jetzt Symptome wie Müdigkeit, Einsamkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten, unspezifische Kopf-, Bauchschmerzen, dann müssen wir in eine andere Richtung gucken.
Aber wir wissen ja, dass die Belastung sozusagen eine Ursache ist. Und da, glaube ich, muss man dann interdisziplinär ansetzen. Aber das so auszuspielen oder zu sagen, stell dich nicht so an, es ist nur psychisch oder psychosomatisch, ist natürlich schwierig, weil dann nicht die entsprechende Versorgung eingeleitet wird.
Hennig: Da spielen ja zwei verschiedene Blickwinkel eine Rolle. Das eine ist der individuelle auf den Patienten oder die Patientin für die Diagnostik, wo man dann sagen kann, ich weiß gar nicht, ob man das so auseinander sortieren muss, auch weil dann eine Bewertung damit automatisch stattfindet. Und das andere ist aber der Forschungsstand. Wenn wir jetzt über Post und Long Covid sprechen, dann muss man gucken, schmeißen wir hier nicht alles in einen Topf und ordnen dann Dinge dem Virus zu, die man nicht mehr zuordnen kann.
Ich würde deswegen später gerne noch mal auf die Diagnostik zurückkommen und wo man tatsächlich versuchen kann, Sachen dingfest zu machen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der mentalen Gesundheit. Wir haben eben über die besonders vulnerablen Gruppen unter den Kindern gesprochen. Es gibt ja aber auch andere, wo die Eltern vielleicht subjektiv sagen: Och, meine Kinder sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen, wahrscheinlich, weil sie privilegiert aufgewachsen sind.
Bedeutung von Resilienz und familiärem Zusammenhalt
Welche Rolle spielt Resilienz, also psychische Anpassungsfähigkeit bei den Kindern an diesem langen, langen Pandemiezustand?
Ravens-Sieberer: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in der COPSY-Studie versucht nicht nur defizitär zu gucken, also zu gucken, was für Einschränkungen gibt es eigentlich hinsichtlich der psychischen Gesundheit? Sondern eigentlich auch: Was hält die Kinder gesund, also was für Ressourcen haben sie? Wir haben natürlich gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die über Ressourcen verfügen, besser mit den Belastungen in der Pandemie umgehen. Und da hat sich sozusagen gezeigt, wenn es einen guten familiären Zusammenhalt gibt, die die Belastungen in der Krise auffangen können, dann ist es einer der wichtigsten Schutzfaktoren überhaupt, denn die Kinder zeigen dann einfach deutlich seltener psychische Auffälligkeiten und auch eine bessere Lebensqualität.
Und man kann wirklich sagen, der familiäre Zusammenhalt wirkt sich schützend und seelisch stabilisierend aus. Und wir haben das gewusst, aber es hat uns doch auch immer wieder sehr erstaunt zu sehen, welche Kraft dann so eine Familie haben kann. Also wenn die Kinder das Gefühl haben, sie sind willkommen und sie fühlen sich wohl, gut aufgehoben, sie werden geliebt, alles wird gut eingebettet und es gibt auch Strukturen im Tagesablauf, dann ist das einfach ein Schutzfaktor, der viele andere Risiken abpuffern kann.
Und was für uns schön war zu sehen, ist, dass das auch schützend wirkt bei Kindern aus Risikofamilien. Auch da muss man sagen, sehen wir deutlich, wenn da der familiäre Zusammenhalt gut ist, auch wenn der Wohnraum beengt ist und auch wenn die finanziellen Ressourcen schlecht sind, dann ist es einfach so, dass diese Belastungen auch bei den Kindern in der Krise aufgefangen werden können.
Hennig: Kann man da was daraus ableiten, wenn man jetzt schon mal ganz kurz einen Blick nach vorn wendet, also in gesellschaftlicher Hinsicht, weil das sind ja krisenhafte Situationen, die in anderer Ausprägung immer wieder auftauchen können - wie so eine Pandemie vielleicht.
Familien stärken
Hoffentlich kommt die nächste Pandemie nicht so schnell wieder, aber dass man auf anderem Wege versuchen muss, Familien zu stärken, als das bisher passiert ist mit anderen Schwerpunkten?
Ravens-Sieberer: Ja, ich glaube, man kann es insofern verallgemeinern, als dass man jetzt sagt, das trifft jetzt nicht nur auf die Pandemie zu, also auf Covid, dass das ein Schutzfaktor ist, sondern generell wahrscheinlich auf Krisen, mit denen die Familie, auch die Kinder und Jugendlichen, die Familie konfrontiert sind. Und wir haben ja natürlich nicht gedacht, dass wir sozusagen so schnell nach der Covid-19-Pandemie die Ukrainekrise haben. Wir sahen die Klimakrise kommen, das war auch für Kinder und Jugendliche ein Thema. Also einfach beängstigende Situationen.
Und da haben wir gesehen, dass man wahrscheinlich gucken muss, dass man jetzt neben diesen ganzen Versorgungsstrukturen auch präventiv vor allen Dingen tätig werden muss, um die Ressourcen von Familien zu stärken. Und auch den Umgang mit solchen Krisen. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Aber ich glaube, dass wir hier jetzt schon sehen, je niedrigschwelliger das angesetzt ist, und je mehr das auch in den Alltag von Familien oder Kindern eingebettet ist und je besser das zugänglich ist, desto mehr nutzt es auch. Also wenn wir Prävention machen, dann müssen wir die da ansetzen, wo die Familien und die Kinder auch sind, also vor allen Dingen zum Beispiel in den Schulen.
Hennig: In den Schulen ist das entscheidende Stichwort. Manchmal hatte ich allerdings auch den Eindruck, dass die Diskussion so ein bisschen verengt nur auf die Schulen fokussiert wurde. Da haben aber auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle gespielt, als wir kontaktbeschränkende Maßnahmen hatten.
Ernährung und Freizeitverhalten von Minderjährigen
Der Freizeitsport zum Beispiel. Ich sehe da einen potenziellen Link zu der Frage der hohen Inzidenzen. Auch bei Kindern ist ja Übergewicht ein Risikofaktor für zum Beispiel schwerere Covid-19-Verläufe. Was für Erkenntnisse haben Sie da über den Verlauf der Pandemie, was Ernährung angeht und stundenlanges Computerspielen statt Sport? Gibt es da Veränderungen? Ist das wieder besser geworden im Laufe der Monate?
Ravens-Sieberer: Wir haben uns neben den psychischen Auffälligkeiten auch das generelle Gesundheitsverhalten angeschaut, auch wenn wir das gerne ausführlicher gemacht hätten, als wir das da tun konnten. Und wir haben gesehen, dass sich auch das während der Pandemie verändert hat. Also wenn Sie jetzt gerade das Essverhalten ansprechen, dann ist es besonders so gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen sich während dieser beschränkenden Maßnahmen ungesünder ernährt haben. Also sie haben mehr Süßigkeiten gegessen.
Sie haben parallel dazu weniger Sport getrieben. Da gibt es ja diese Empfehlungen, dass man einmal am Tag sozusagen moderate körperliche Aktivität machen sollte. Das war eigentlich fast gar nicht mehr der Fall
Medienkonsum
Also ganz viele sind nicht mehr aus dem Haus gegangen und auch der Medienkonsum hat zugenommen. Wobei ich sagen muss, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wir natürlich immer vor zu hohem Medienkonsum warnen. Aber auf der anderen Seite war es ja oft die einzige Möglichkeit, um die Nähe zur Schule zu halten und auch den Kontakt mit Freunden aufrechtzuerhalten. Also wir wissen natürlich, viel Bildschirmzeit führt zu Unzufriedenheit und kann auch zur Abhängigkeit führen.
Aber ich finde, die Kinder und Jugendlichen haben während dieser Zeit des Lockdowns auch diesen Medienkonsum für sich gut genutzt, um eben in Kontakt mit den engsten Freunden zu bleiben und auch in Kontakt mit der Schule zu bleiben. Also sie haben es eigentlich auch für sich als Ressource umgewandelt, das muss man schon sagen. Es war eine gute Strategie und es war auch wichtig. Was uns natürlich aufgefallen ist, dass die Kinder in der zweiten Befragung viel weniger Sport gemacht haben als zuvor. Das verwundert auch nicht, weil da waren ja auch fast alle Freizeiteinrichtungen geschlossen.
Aber es waren doch fast 40 Prozent der Kinder, die dann überhaupt nicht mehr sportlich aktiv waren. Und jetzt mal im Vergleich vor der Pandemie waren das nur vier Prozent. Also man konnte wirklich sehen, dass da so eine Inaktivität stattfand. Und das kann eben zum Teil auch erklären, warum es den Kindern und Jugendlichen in der zweiten Befragung, während des Lockdowns, psychisch eigentlich noch schlechter ging als vorher.
Denn wir wissen ja, dass Bewegung und Sport auch ganz wesentlich sind für das psychische Wohlbefinden. Und wenn es einfach mangelnde Bewegung gibt, wirkt sich das auch negativ auf die Stimmung aus und kann zum Beispiel zur Entstehung von depressiven Symptomen beitragen.
Hennig: Das war in der dritten Befragung dann aber wieder besser.
Ravens-Sieberer: Das war besser. Einfach, weil es natürlich auch mehr Möglichkeiten gab, wieder den Hobbys nachzugehen. Sportveranstaltungen waren möglich, es gab wieder die Schule. Also im Grunde genommen hatte sich da sehr viel über den Sommer gebessert und deswegen hat sich auch das Gesundheitsverhalten gebessert. Das mit dem Essverhalten war sozusagen gleich geblieben. Und da gab es auch schon erste Berichte, dass es während der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen vermehrt zu Essstörungen kommt, in beide Richtungen, also sowohl Anorexie oder Bulimie, also weniger zu essen, als auch Adipositas. Also hier geht es in beide Richtungen.
Hennig: Haben Sie da schon Erkenntnisse aus der nächsten Befragung, was diesen Punkt angeht?
Ravens-Sieberer: Die haben wir leider noch nicht so ausgewertet, dass ich das jetzt wirklich guten Gewissens sagen könnte.
Essstörungen während der Pandemie
Aber da haben wir natürlich zum ersten Mal auch die Essstörungen so erfasst, dass wir da bessere Aussagen treffen können. Denn vorher haben wir ja jetzt nur nach dem Konsum von zum Beispiel Süßigkeiten gefragt. Aber nachdem sich die Berichte häuften, dass es sozusagen einen Anstieg der Essstörungsfälle gibt, haben wir hier auch noch weitere Screening-Instrumente hinzugenommen.
Hennig: Die Befragungswelle ist aber abgeschlossen?
Ravens-Sieberer: Ja, die ist abgeschlossen. Aber die Daten sind noch nicht wirklich so aufbereitet, dass wir sie gut auswerten können. Wir rechnen damit jetzt im Verlauf des Sommers.
Hennig: Herr Vilser, dieser Punkt gesundheitlicher Grundzustand durch den Einfluss von Bewegung und Ernährung spielt der eigentlich auch eine Rolle? Kann man irgendwas über die Frage nach Langzeitfolgen des Virus sagen?
Vilser: Bezogen auf das Virus würde ich mich da nicht auf irgendwas einlassen wollen. Dass das natürlich nicht für das mentale Wohl und für das Körperliche eine riesige Rolle spielt, das ist zweifelsohne so. Ich bin ja Kinderkardiologe und wenn ich mir überlege, was für katastrophale Auswirkungen das hat, wenn die Kinder wirklich über eine längere Zeit vom Sport ferngehalten werden, auch aus Kostengründen werden die aus Vereinen abgemeldet.
Und wir wissen leider, wer einmal aus dieser regelmäßigen Routine rausfällt, die kriegen wir nicht alle wieder. Mit der mangelnden Bewegung nimmt die Adipositas zu, die eh auch schon ein gewisses Problem ist. Und die ganzen Kreislaufstörungen, die da dann irgendwann dranhängen, die werden unter Umständen kommen. Und das hoffe ich sehr, dass wir das wieder in Griff bekommen, dass wir die Kinder wieder in die Bewegung zurückbekommen und von den Monitoren weg, was nicht leicht ist.
Symptomatik für Post Covid bei Kindern
Hennig: Wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich auch in der Forschungsliteratur zu Post Covid und diesem Zusammenhang nicht wirklich was entdecken können. Aber sehen Sie denn subjektiv bei den Kindern, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen, irgendwelche Auffälligkeiten, dass das vermehrt Kinder sind, die genau solche Bewegungs- und Ernährungsprobleme haben? Oder ist das genau der gleiche Querschnitt, wie man Kinder auch sonst in den Praxen sieht?
Vilser: Ich denke, dass das der gleiche Querschnitt ist. Es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten. Das führende Symptom ist eigentlich eine Fatigue-Symptomatik. Das heißt, sie sind schlecht belastbar. Und jemand, der schlecht belastbar ist oder der, wenn er sich bewegt, ständig über Schwindel klagt oder ähnliche Dinge, der bewegt sich dann eben auch nicht mehr und der kann sich nicht mehr belasten. Deswegen ist es relativ schwierig, zu sagen, waren das Kinder, die jetzt direkt, bevor sie das Virus erwischt hat, auch nur zu Hause gesessen haben? Deshalb fragen wir in der Art nicht.
Hennig: Wenn wir jetzt gerade bei den Symptomen sind, dann lassen Sie uns dabei mal bleiben. Wir haben hier auch im Podcast in einer anderen Sonderfolge schon viel über Symptome bei Long Covid und Post Covid gehört. Und das, was die Erwachsenen betrifft, das ist ganz ähnlich bei Kindern, oder?
Vilser: Ja, das ist eigentlich ganz genau dieselbe Symptomatik mit vielleicht minimal anderen Verteilungen. Das häufigste wie bei den Erwachsenen ist eine Fatigue-Symptomatik, eine schlechte Belastbarkeit, das ist die häufigste Fragestellung. Störungen von Geruch und Geschmack, Atemprobleme. Dieses ganze Brain Fog, also Aufmerksamkeitsstörung, Merkstörungen, eine Verlangsamung beim Bearbeiten von mentalen Aufgaben, Schmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Herzrasen, Schwindel, das alles findet sich genauso wieder wie bei den Erwachsenen.
Hennig: Sind es hauptsächlich Kinder, die dann tatsächlich auch mit mehreren Symptomen gleichzeitig kommen? Also bei Chronic Fatigue kann man sich gut vorstellen, wie stark das beeinträchtigt. Bei den kleineren Symptomen, sage ich mal, werden sie natürlich dann relevant, wenn man drei oder vier hat.
Vilser: Ja, es ist schon so, dass die meistens mehr als zwei, drei haben, wenn sie zu uns kommen. Wir sind ja auch nicht die erste Anlaufstelle. Wir fordern ja, dass der Kinderarzt sich vorher mit den Patienten beschäftigt hat, dass das nur über den Kinderarzt geht. Wir möchten keine alleinige Selbstvorstellung von dem Patienten haben und haben deswegen auch einen gewissen Filter, von dem ich glaube, dass die ganz milden Fälle bei uns gar nicht landen. Deswegen haben wir schon meistens mit Patienten zu tun, die mehrere Probleme haben oder doch gravierende Probleme.
Diagnostik von Post Covid in der Ambulanz
Hennig: Wenn ich mit meinem Kind zum Beispiel zu Ihnen in die Ambulanz komme, die Infektion ist erst drei Wochen her, das Kind hat anhaltend Müdigkeit, Kopfschmerzen. Dann sagen Sie eigentlich: Das ist zu früh, oder? Drei Wochen nach der Infektion.
Vilser: Sie kommen nicht zu uns in die Ambulanz mit drei Wochen. Da hätte einer unserer Filter versagt. Tatsächlich möchten wir innerhalb der ersten vier Wochen die Kinder wirklich nur dann sehen, wenn die Symptome so sind, dass sie auch auf eine bedrohlich andere Erkrankung hinweisen könnten. Wenn zum Beispiel nach zwei Wochen jemand kommt und sagt, er hat das Gefühl von permanentem Herzrasen und in diesen Phasen ist er ganz schlecht belastbar und der Puls ist auf einer Pulsuhr oder durch das händische Messen über 200 gewesen.
Das ist es natürlich so, da sage ich: Okay, ihr müsst unbedingt und zeitnah kommen. Wir müssen ja ausschließen, dass sich eine Myokarditis in Folge der Erkrankung eingestellt hat, was es halt gibt. Mit den diffusen und für Long Covid typischen Beschwerden empfehle ich, erst mal mindestens die ersten vier Wochen, eigentlich besser noch die ersten sechs, acht Wochen abzuwarten.
Diagnose Long Covid bei Kindern
Hennig: Was machen Sie dann, wenn Sie versuchen, eine Diagnose zu stellen, die ja auch idealerweise möglichst differenziert sein sollte, um dann zu gucken: Was kann ich denn tatsächlich an Therapie anbieten? Da kommen die verschiedenen Fachrichtungen zum Tragen. Wird auch eine Blutuntersuchung gemacht auf Biomarker, Entzündungsstoffe?
Vilser: Ja, man muss zugeben, dass wir zurzeit noch viel zu viel machen. Wir gucken auch, weil wir das eben noch nicht gut einschätzen können und weil wir es besser kennenlernen müssen, uns das Ganze extrem breit an. Normalerweise arbeitet man als Pädiater und als Arzt generell ein bisschen symptomfokussiert. Das heißt, wenn jemand mit Bauchschmerzen kommt, dann beschäftige ich mich mit Bauchschmerzen und schaue mir den Darm an, den Stuhl im Wesentlichen. Und erst, wenn die erste Stufe nichts gebracht hat und die Beschwerden massiv weiter da sind, gucke ich dann weiterführend nach systemischen oder anderen Dingen.
Wir gehen etwas anders ran. Wir machen von vornherein eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Diagnostik, wo zum Beispiel ein Herz-Ultraschall dazugehört, ein EKG, eine Lungenfunktion, eine Blutentnahme mit wirklich ganz vielen Parametern, die die Funktionen der verschiedenen Organe anzeigen, die die Entzündungszeichen anzeigen, die Antikörper untersuchen, die Autoantikörper. Wirklich ganz vielen Dinge. Diese Diagnose Long Covid ist eigentlich medizinisch völlig unbrauchbar, weil sich so viele verschiedene Patienten darunter subsumieren, die wahrscheinlich eine andere Pathogenese haben, die zu diesen Symptomen führt und dementsprechend auch anders behandelt werden müssen.
Und wir müssen die einfach noch viel besser beschreiben. Wir müssen diese verschiedenen Cluster noch viel besser einordnen, damit wir die irgendwann sinnvoll auch einer Therapie zuführen können. Im Moment ist deswegen noch dieser Wust an Untersuchungen, Kreislaufbelastungstest. Unsere Psychologin unterhält sich lange mit den Patienten. Und je nachdem, was die dann noch an Symptomen schildern, geht es dann bis hin zum MRT, EEG.
Dauer der Symptome und Erforschung von Mechanismen
Hennig: Aus Patientensicht, sowohl Kinder und Jugendliche selbst als auch die Eltern, da ist ja natürlich die Frage ganz entscheidend: Geht das wieder weg? Wann geht das wieder weg? Was weiß man schon über die Dauer der Symptome bei diesen Fällen, die zu Ihnen kommen, also wo sich das nicht innerhalb von ein paar Wochen von selber erledigt?
Vilser: Auch die haben noch eine gute Prognose. Das heißt, die Patienten, die ich jetzt vor einem Jahr gesehen habe, sind jetzt überwiegend symptomfrei oder deutlich symptomgemildert. Aber die Patientin, die das jetzt am längsten hat, die hat sich während der ersten Welle im April infiziert und ist immer noch schwer beeinträchtigt. Also es gibt einen kleinen Teil, bei dem das vermutlich in eine chronische Erkrankung übergeht, die dann ziemlich ähnlich ist wie die ME/CFS, dieses Chronic Fatigue-Syndrom. Aber die meisten, und das ist eigentlich das, woran man sich festhalten sollte, werden wieder besser.
Hennig: Das entspricht ja auch ein bisschen dem, was die internationale Forschungsliteratur dazu zumindest schon sagen kann. Sie haben jetzt aber auch eine eigene Studie initiiert in Kooperation mit Kollegen aus Ilmenau und Magdeburg, die dem Phänomen noch ein bisschen tiefer nachgehen, auch was die langfristigen Folgen angeht.
Haben Sie denn Anlass zur Befürchtung, dass es Patienten gibt, bei denen Post Covid und Long Covid ihrerseits ein Risiko für wiederum chronische Erkrankungen darstellt? Also Chronic Fatigue-Syndrom, aber vielleicht auch langfristig Autoimmunerkrankungen?
Vilser: Wir beschäftigen uns in der Studie mit körperlichen und psychischen Problemen. Der Hauptanspruch ist: Wir wollen Cluster finden, wir wollen mit dieser extrem genauen und intensiven Art, die Patienten anzuschauen, für Pathogenese Erklärungen finden und wollen die gerne einordnen. Also zum Beispiel wollen wir jemanden finden, der möglicherweise seine Symptome aufgrund von Mikrothromben hat.
Oder jemanden, der seine Symptome aufgrund von Autoantikörpern hat. Oder eben aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen. Und daraus folgend natürlich auch schauen, welche Therapien sind dann für den möglich? Das macht ja einen völligen Unterschied, ob jemand während der primären Erkrankungen eine Zerstörung des Lungengewebes bekommen hat oder eben Autoantikörper entwickelt hat, wie der später behandelt werden soll.
Und wir wollen schauen, haben diese Kinder eine Prädisposition möglicherweise für andere Erkrankungen, die sie entweder empfänglicher dafür machen, Long-Covid-Symptome zu haben? Oder hat sich ihre Immunität und die Art, auf Infektionen oder auf Allergien zu reagieren, möglicherweise verändert, sodass sie zukünftig andere Probleme haben könnten, wie zum Beispiel, dass Allergien leichter entstehen. Das ist alles Teil dessen, was wir uns gerne anschauen würden.
Hennig: Sie haben jetzt auch psychische Auswirkungen angesprochen. Was weiß man grundsätzlich über psychische Auswirkungen bei anderen Viren?
Vilser: Ja, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, dass in Jena an dem Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit auch der Ansatz verfolgt wird, dass Infektionen möglicherweise das biochemische Ungleichgewicht so verändern, dass psychische Erkrankungen entstehen könnten. Also insofern gibt es da schon etwas, wo ich einen Zusammenhang sehen würde oder sehen könnte. Sagen wir es mal so. Das ist alles noch sehr jung. Aber ich bin da ganz sicher auch weit vom Expertenstatus entfernt, deswegen sollte ich vielleicht besser aufhören zu reden.
Therapiemöglichkeiten
Hennig: Sie haben aber eben Therapiemöglichkeiten angesprochen, solange das Bild so disparat ist und noch in den Anfängen steckt, was die Erforschung und die Beobachtung angeht, ist es ja wahrscheinlich ziemlich schwierig. Trotzdem, was für Möglichkeiten gibt es noch? Was für Therapiemöglichkeiten, die Sie den Patientinnen anbieten können?
Vilser: Man muss leider erst mal festhalten, es gibt Stand jetzt keine kausale Therapie.
Hennig: Also nur symptomatisch.
Vilser: Genau, ich hätte gerne irgendetwas, mit dem ich sagen kann, das nehmen wir und das hilft. Und ich bin auch der festen Überzeugung, diese eine kausale Therapie für alle Patienten, die wir im Moment unter dem Post-Covid-Syndrom zusammenfassen, die wird es nie geben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir ganz verschiedene Cluster haben, dass wir verschiedene Pathogenesen haben, die zu den Symptomen führen und dass die unterschiedlich behandelt werden müssen.
Und solange wir nicht genau rausgefunden haben, was das ist, ist es eben schwierig, eine maßgeschneiderte Therapie zu finden. Wir haben schon gute Ansätze. Zum Beispiel, wenn wir uns über die Autoantikörper unterhalten, da wird hier in Deutschland in Erlangen mit einer Studie der BC007 geprüft, das ist ein Wirkstoff, der genau gegen diese Autoantikörper gerichtet ist und der möglicherweise einem Patienten hilft, bei dem es das Problem ist.
Hennig: Also Antikörper, die sich fälschlicherweise gegen das eigene Immunsystem richten.
Vilser: Richtig. Antikörper, die möglicherweise durch Corona gebildet werden oder die getriggert werden und richten sich danach gegen Gewebe des eigenen Körpers und machen verschiedenste Probleme.
Hennig: Gibt es da einen Zusammenhang zur Antikörperantwort bei Kindern? Zumindest in der Theorie, weil die ja eigentlich sehr, sehr gut reagieren mit ihrem Immunsystem, wie man weiß, dass da auch leichte Überreaktionen stattfinden können und dann so eine Autoantikörper-Bildung getriggert wird.
Vilser: Wir fangen ehrlich gesagt gerade erst an, nach diesen Autoantikörpern auch in unserem Kollektiv zu suchen. Und es gibt jetzt für ein pädiatrisches Kollektiv noch nicht wirklich viele Studien, die sich das gut angeschaut haben. Das muss jetzt alles erst kommen. Aber wir versuchen, das jetzt mit anzuschauen, um dann auch, wenn diese Studie in Erlangen tatsächlich Erfolg haben sollte, für die Patienten, die das bei uns betrifft, möglicherweise eine Therapie zu haben. Also kausale Dinge in der Forschung, aber noch nichts etabliert.
Und deswegen behandeln wir symptomatisch. Symptomatisch klingt immer so, als ob man nichts machen würde. Das ist nicht so. Wir haben schon noch Dinge, mit dem man dem Patienten auch wirklich helfen kann. Das fängt mit ganz basalen Sachen an, wie dass man, wenn man Schmerzen hat, auch mal ein Schmerzmittel nehmen darf. Das wird im pädiatrischen Kollektiv gerne vergessen. Wenn wir uns alle überlegen, wie fühlen wir uns, wenn wir 39 Grad Fieber haben? Dann greift jeder, oder die meisten, zu einem Schmerzmittel. Und bei den Kindern vergisst man das ganz oft. Auch die dürfen Schmerzmittel haben.
Wenn es Schlafstörungen gibt, dann muss man sich anschauen, worin bestehen die Schlafstörungen? Kann das Setting des Schlafens etwas verändern? Man kann auch mal ein Schlafmittel geben. Wir agieren natürlich mit Physiotherapie bei den Patienten, bei denen wir glauben, dass sie davon profitieren. Da muss man aber vorher in der Anamnese sehr genau hinschauen. Sind es möglicherweise Patienten, die eine Post-Exertional Malaise haben? Das heißt Patienten, die bei einer Aktivierung, bei einer Belastung und das ist bei jedem ein bisschen anders richtige Crashs erleiden. Da muss man sehr vorsichtig sein mit einer aktivierenden Physiotherapie.
Und deswegen ist diese Klassifizierung wieder so wichtig. Wir haben Ergotherapie, wir haben eine Psychotherapie. Wenn wir Vitaminmangel finden, nach denen wir suchen, dann gleichen wir die aus. Wenn wir einen Eisenmangel feststellen oder auch nur grenzwertige Befunde, dann versuchen wir das auszugleichen. Wir machen Riech- und Schmecktraining. Also es gibt da ein paar Dinge, die man auch zur Verfügung hat.
Risikofaktoren und Verlauf der Akutinfektion
Hennig: Stichwort Klassifizierung. Was sind denn so Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen, die Sie vielleicht schon kennen für Long und Post Covid? zum Beispiel die Zahl der Symptome oder die Schwere der Symptome bei akuter Infektion. Spielt das eine Rolle?
Vilser: Nicht so richtig. Bei Kindern noch weniger als bei Erwachsenen. Man kann natürlich sagen, wenn jemand jetzt mit der primären Erkrankung schwerstkrank gewesen ist und im schlimmsten Fall sechs Wochen auf der Intensivstation gelegen hat, möglicherweise noch an einer künstlichen Herz-Lungen-Maschine, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nach zwölf Wochen richtig fit ist, nicht sehr hoch.
Das ist aber eigentlich eine andere Entität. Das geht dann eher in Richtung Post Critical Care Syndrom, also eine schwere Erkrankung, von der man sich nur langsam erholt. Und die trifft in unserem Kollektiv, wo die Erkrankung meistens sehr milde verläuft, wenig Patienten. Und dass man jetzt wirklich bei Kindern einen Risikofaktor zum Zeitpunkt der Infektion identifizieren kann, wo man sagt: Okay, die haben ein hohes Risiko, Long Covid zu entwickeln. Das wüsste ich derzeit noch nicht. Ich weiß, dass es bei Erwachsenen einige Beschreibungen gibt, wo sie versuchen, dahin zu gehen, aber bei Kindern kenne ich das noch nicht.
Hennig: Das heißt aber im Umkehrschluss eben auch, Sie sehen auch Kinder, die keine oder nur sehr, sehr, sehr schwache Symptome gehabt haben, als sie akut infiziert waren, die dann Post Covid oder Long Covid entwickeln.
Vilser: Ja, sogar überwiegend, weil das ja die häufigste Form bei den Kindern ist. Deswegen haben die Kinder, die wir überwiegend sehen, eine milde Erkrankung gehabt oder teilweise sogar symptomlos. Also sie hatten nur einen positiven PCR-Test.
Hennig: Jetzt muss man aber auch eine Sache grundsätzlich dazusagen. Es ist nicht so, dass man das von anderen Viren nicht kennt, dass die langfristige Folgen haben können, also zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, dass das Pfeiffersche Drüsenfieber macht. Das kennen vielleicht einige, wie langfristig sich das auswirken kann. Sehen Sie das bei Influenza zum Beispiel auch bei Kindern und Jugendlichen?
Vilser: Sie haben es schon angesprochen, am bedeutendsten ist sicherlich das Epstein-Barr-Virus in dem Zusammenhang, wo es diese postviralen Fatigue-Syndrome, ich glaube, bei fünf bis zehn Prozent der Fälle gibt. Und die auch in einem relevanten Anteil dann eben in ME/CFS übergehen können. Also ja, wir kennen das auch schon von anderen Viren, auch von Influenza, wenn auch nicht ganz in dem Maße. Und natürlich, wir haben eben nicht diese Pandemiezustände, also diese massive Häufung von Infektionen und damit so viele Fälle gleichzeitig. Das ist das, was es so ein bisschen problematisch macht.
Risikoreduktion durch Impfung
Hennig: Welche Rolle kann denn die Impfung spielen? Weiß man da schon was drüber? Es gibt ja bei Erwachsenen zum Beispiel mittlerweile so vorsichtige Schätzungen, dass eine Covid-19-Impfung das Risiko für Post und Long Covid immerhin halbieren kann. Haben Sie Anhaltspunkte, dass das bei Kindern auch eine Rolle spielt?
Vilser: Ja, das würde ich einfach, wie das oft ist bei den Kinderärzten, brutal auf Kinder runterpolieren und sagen, das wird da genauso sein. Es gibt keine Studie dazu und wir sind oftmals darauf angewiesen, wenn es um Pathogenese geht, wenn es um solche großen Untersuchungen geht, Erwachsenendaten herzuleiten. Und ich glaube, das ist in dem Fall durchaus machbar. Ich würde auch davon ausgehen, dass zumindest die postpubertären Kinder eine ähnliche Risikoreduktion durch die Impfung haben.
Hennig: Sehen Sie denn aber auch geimpfte Kinder bei sich, die trotz Impfung schwerkrank werden?
Vilser: Ja, eine Risikoreduktion von 50 Prozent heißt ja, man hat nach Impfung bloß noch das halbe Risiko, es ist halt nicht null. Und damit sehen wir natürlich auch Kinder nach einer Impfung mit einer Durchbruchsinfektionen, die auch schwer krank sind.
Autonomie, Selbstwirksamkeit und aktiver Infektionsschutz der Kinder
Hennig: Das Stichwort Impfung ist ja gerade bei Kindern ein ganz spezielles, weil es da eben nicht so eine pauschale Impfempfehlung für alle Kinder gegeben hat. Aber als es dann die Impfung für ältere Kinder und dann auch für jüngere gab, hat das eigentlich aus Sicht der Kinder und Jugendlichen eine Rolle gespielt im Sinne der Autonomie? Also: Jetzt gibt es etwas, was ich machen kann, um mich zu schützen und vielleicht ja auch ein bisschen die Angehörigen zu schützen.
Ravens-Sieberer: Das sprechen Sie mit der Autonomie an, sozusagen die Möglichkeit zu handeln. Das ist ja immer ganz wichtig und kann auch die Ängste nehmen. Das betrifft das Impfen, aber das betrifft ja genauso andere Maßnahmen wie Masketragen, Hände desinfizieren. Wir können generell sehen, dass eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen das deswegen begrüßt wurde, weil es ihnen ein Stück der Kontrolle zurückgegeben hat. Wobei wir sagen müssen, ob die Kinder, gerade die jüngeren, geimpft sind oder nicht, hängt ja nicht von den Kindern ab, sondern von den Eltern.
Und da sehen wir mittlerweile wahrscheinlich auch so ein Stagnieren der Bereitschaft. Also wer sein Kind impfen lassen möchte, der hat das in der Regel getan. Und unter den Eltern, die ungeimpfte Kinder haben, ist auch selber die Impfbereitschaft niedrig. Aber dennoch ist es so, dass es bei den Eltern und auch bei den älteren Kindern, also bei den Jugendlichen, deswegen begrüßt wurde, weil es einem Handlungsfelder ermöglicht und weil man sozusagen aktiv werden kann, um sich zu schützen und auch um sein Umfeld zu schützen.
Hennig: Das ist etwas, was man in der öffentlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen nachvollziehen konnte, nämlich immer dann, wenn sich so Landesschülerräte oder so zu Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulen geäußert haben und manchmal gesagt haben: Wir möchten eigentlich bestimmte Maßnahmen gerne noch beibehalten, um geschützt zu bleiben. Da muss man sagen, das sind natürlich ältere Kinder und Jugendliche vor allen Dingen. Welche Rolle spielen dann aber auch noch andere Maßnahmen? Sind Masken ein Thema, das auch unter dieses Stichwort Autonomie fällt? Also ich kann mich schützen. Und das spielt dann eine Rolle für das Wohlbefinden der Kinder, für die Lebensqualität?
Ravens-Sieberer: Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sozusagen das Tragen von Masken mit geringerem psychischen Stress verbunden sein kann. Das könnte daran liegen, dass man sich selber besser geschützt fühlt und auch weniger Angst vor Ansteckung empfindet. Aber natürlich auch, dass man selbstwirksam wird, also dass man aktiv wird und etwas dazu beiträgt, dass man nicht nur selber, sondern sozusagen auch das Umfeld geschützt ist.
Und immer, wenn man sozusagen handeln kann und nicht vor Angst gelähmt ist, dann ist das auf jeden Fall etwas, was das Wohlbefinden verbessert und auch die psychische Situation stabilisieren kann. Man gewinnt ein Stück Kontrolle zurück, subjektiv zumindest, wahrscheinlich auch objektiv, aber man kann etwas tun. Und Sie haben die Schüler angesprochen und ich fand das sehr bemerkenswert, dass die ja aktiv gefordert haben, auch in solche Prozesse, wie zum Beispiel Leitlinienentwicklung mit eingebunden zu werden, um wirklich selber aus ihrer Sicht mitbestimmen zu können, was sie eigentlich aktiv tun können, um dieser Pandemie etwas entgegenzusetzen.
Und das ist auch gehört worden. Vielleicht nicht so sehr, wie man sich das aus meiner Sicht wünschen würde, aber auf jeden Fall sind jetzt auch die Schülervertreter in diversen Expertenräten vertreten und können mitgestalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil immer dann, wenn man das Gefühl hat, man kann aktiv etwas tun, nimmt es einem die Ängste.
Hennig: Noch einmal ganz kurz nachgefragt beim Stichwort Masken, weil das ja auch ein heiß umkämpftes Thema unter Erwachsenen ist, dass es viele Menschen gibt, die sagen, die Masken beeinträchtigen die Kinder und Jugendlichen extrem und die müssen so schnell wie möglich fallen. Ist das also was, dass Sie aus Ihren Daten so nicht ableiten können, also dass die Beeinträchtigung aus Sicht der Kinder und Jugendlichen gar nicht so groß ist?
Ravens-Sieberer: Nein, das können wir aus unseren Daten nicht ableiten. Wir haben ja auch gefragt, was sozusagen am hinderlichsten empfunden wird und was als besonders schlimm empfunden wird. Und da sind die Masken auf keinen Fall das Thema. Und wenn ich mir angucke, es gibt ja sozusagen auch eine S3, also eine Leitlinie zum Umgang mit der Pandemie, auch in den Schulen. Auch da wurde Evidenz zusammengetragen. Und da ist es zum Beispiel jetzt nicht so, wie viele Eltern befürchten, dass die Masken am Atmen hindern oder dass die Kinder nicht genug Luft bekommen würden. Das lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Dafür gibt es gar keine Evidenz.
Hennig: Herr Vilser, hätten Sie sich in der gegenwärtigen Situation gewünscht, dass einige Maßnahmen im Sinne der Kinder zum Infektionsschutz noch länger aufrechterhalten worden wären?
Vilser: Es ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite immer wieder zu fordern, den Kindern ihre Kindheit zurückzugeben, was natürlich heißt, möglichst wenig Maßnahmen. Und sich auf der anderen Seite mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, und auch mit Folgen der Erkrankung. Und auch zu sagen, das ist durchaus relevant für Kinder. Es ist ein wirklich schwieriger Kompromiss. Ich denke, bei den Dingen, die ich als wenig beeinträchtigend sehe, da gehört zum Beispiel das Masketragen dazu, für alle, nicht nur für die Kinder. Das hätte man einfach wirklich noch länger machen können.
Ich finde es immer dann schwierig, wenn man sagt: Okay, wir, die Erwachsenen, die Alten, die müssen das nicht mehr machen, obwohl die eben eher betroffen sind, schwere Komplikationen zu haben. Aber hier in der Schule, bei den Kindern, da lassen wir das noch, das sind ja bloß Kinder. Also immer dann wird es schwierig. Ich hätte mir das für alle gewünscht. Ich würde mir auch noch weiter wünschen, dass wir möglichst lange in öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade wenn die jetzt freigegeben werden und man sich dann dort wieder in guter alter Tradition zusammenbalgt, dass man dann sich doch noch mal die Maske aufsetzt.
Freiwillig geht das ja immer, aber wir wissen ja alle, wie es mit Freiwilligkeit ist. Das wird dann einfach weniger mit der Zeit.
Hennig: Vielleicht ist auch da ein Weg, zum einen bei den Erwachsenen ein bisschen mehr die Kandare anzuziehen. Und zum anderen das, was Frau Ravens-Sieberer gerade sagte, auch mit den Kindern und den Jugendlichen zu sprechen, was sie denn eigentlich auch als einschränkend empfinden und wo sie bereit sind, etwas mitzutragen. Ich möchte noch mal kurz auf die Impfung kommen.
Impfempfehlung auch für jüngere Kinder?
Frau Ravens-Sieberer sagte eben, die meisten, die ihre jüngeren Kinder haben impfen wollen, die haben das möglicherweise auch getan. Voraussetzung ist aber natürlich auch, dass genug Informationen an die Eltern überhaupt rankommen. Und wir wissen, dass der Zugang zu Informationen in der Impfkampagne bei manchen gesellschaftlichen Gruppen ein bisschen schwierig war. Und die Stiko-Empfehlung ist ja sozusagen für Kinder unter zwölf so eine Art Zwitterwesen, also keine echte Empfehlung für alle, andererseits aber der Segen von Seiten der STIKO für die, die es aus eigener Initiative machen. Herr Vilser, empfehlen Sie Ihren jüngeren Patienten die Impfung gegen Covid-19?
Vilser: Da muss man jetzt mal überlegen, wer ist mit meinen Patienten gemeint? Wenn mit meinen Patienten die herzkranken Kinder gemeint sind, dann ja. Die, die schon Covid gehabt haben und jetzt unter Langzeitproblemen leiden, bei denen ist es ein kleines bisschen schwieriger. Eine Zeit lang wurde diskutiert, ob die Impfung möglicherweise nicht durch eine Art ein Immunbooster ist, also dass man sagt, wir geben den Immunsystem noch mal so richtig was zu tun, und das setzt sich mit der Erkrankung auseinander und bekämpft möglicherweise damit diese Symptome, die durch eine eventuell Viruspersistenz auch entstehen, die wir dann Long Covid nennen. Da hat sich gezeigt, dass das nicht so richtig was gebracht hat. Das heißt, bei den meisten hat es keine Veränderung getan, bei einigen ist es schlechter geworden, bei einigen besser. Deswegen kann man das also nicht als Therapie verkaufen.
Impfung als Schutzmaßnahme
Aber als Schutzmaßnahme empfehle ich es meinen Patienten letzten Endes schon, weil ich davon ausgehe, dass in diesem Herbst die Infektionszahlen wieder massiv hochgehen werden, weil ich schon ein bisschen Respekt davor habe, was für Mutanten in Umlauf kommen. Und wir werden damit rechnen müssen, dass das Virus weitermutiert.
Ich glaube, da zweifelt keiner so richtig. Und wir werden vielleicht nicht immer das Glück haben, dass es in die Richtung mutiert, wie es bei Omikron der Fall war, dass wir weniger Krankheitsschwere haben. Und wenn man davon ausgeht, ich habe jetzt die Wahl zwischen der Impfung oder dem Virus, dann würde ich mich immer für die Impfung entscheiden und nicht für das Virus.
Hennig: Das heißt, ich habe das jetzt eben auf die Patienten verengt gefragt, wenn ich es offener frage: Freunde, die Sie fragen, die gesunde Kinder haben, wo sie zumindest nicht wissen, ob sie Vorerkrankungen haben, denen raten Sie auch zu, wenn Sie gefragt werden?
Vilser: Ja, ich rate denen dazu. Ich sage aber immer dazu, dass es tatsächlich derzeit eine nahezu Fifty-Fifty-Entscheidung ist. Die USA hat sich natürlich unter dem Hintergrund von anderen Daten, was Erkrankungsverlauf und -schwere und auch PIMS betrifft, dazu entschieden, eine generelle Empfehlung auszusprechen, die es bei uns nicht gibt. Ich finde, die Entscheidung der Stiko ist, so wie es jetzt ist, nachvollziehbar. Ich empfehle Freunden, die mich fragen, eher das Risiko der Impfung in Kauf zu nehmen, als das der Infektion, wohl wissend, dass das Risiko bei beiden gering ist. Das muss man auch immer wieder sagen.
Hennig: Das Risiko bei der Impfung ist aber auch nach allem, was man weiß, bei jüngeren Kindern noch mal geringer. Stichwort Myokarditis.
Vilser: Dieser reduzierte Impfstoff bei den kleineren Kindern, der hat wirklich noch mal eine erheblich bessere Verträglichkeit, gerade was diese akuten Probleme angeht. Und was die Myokarditis angeht, das kann man mittlerweile ganz gut sagen. Was man vielleicht auch einmal erwähnen muss, ist, dass es auch in Verbindung mit der Impfung Beschreibungen von Post-Covid-Symptomen gibt, dass also auch Kinder und Erwachsene, die geimpft worden sind, Symptome entwickeln, die letzten Endes ganz genauso aussehen. Das ist natürlich noch schwieriger zu werten. Es ist extrem selten von dem, was wir bisher wissen, aber das muss man zumindest auch einmal erwähnen, dass es das auch gibt.
PostVac-Syndrom
Hennig: Extrem selten heißt aber auch, das ist natürlich auch immer eine Frage des Meldewesens. Wie weit kommt es tatsächlich dann an, wo diese Daten gesammelt werden? Aber ich habe mit Klaus Cichutek, dem Präsidenten des Paul Ehrlich-Instituts darüber gesprochen. Und er sagt: Ja, wir nehmen das wahr, zumindest was Chronik Fatigue-Syndrom nach Impfung angeht. Aber es ist noch unterhalb eines Risikosignals. Das heißt, das ist noch nicht definiert als offiziell festgestellte Nebenwirkung der Impfung.
Vilser: Genau. Deswegen, ich wollte es nur erwähnt haben, wenn man eben dieses Krankheitsbild behandelt und eher die Impfung propagiert, und ich bin wie gesagt eher für die Impfung, dass man da nicht außen vor lassen sollte, dass die Diskussion auch noch im Orbit steht.
Hennig: Haben Sie bei sich auch solche Fälle gesehen?
Vilser: Ja, ich habe Kontakt mit einigen Patienten, die ich genauso bei uns anschaue, wie wir die Patienten anschauen, die eine Infektion gehabt haben. Aber auch mit dem gleichen Ergebnis, muss man sagen. Sprich, in der Regel finden wir jetzt keine wirklich zugrunde liegende Erkrankung. Wir sehen keine schwere Beeinträchtigung der Organe. Und haben bei denen genauso das Problem wie bei dem Post-Covid-Syndrom, dass wir eben keinen handfesten Biomarker haben, mit dem wir das eine oder andere beweisen können.
Hennig: Vielleicht ein Hinweis an der Stelle, auch wenn das zahlenmäßig offenbar sehr selten ist. Wir haben uns in einem etwas ausführlicheren Beitrag bei NDR Info auch mit diesem Post-Vac-Syndrom beschäftigt, also Post-Covid-Symptome nach Impfung. Auch den Beitrag kann man nachhören in der Reihe "Wissenschaft in fünf Minuten" in der ARD Audiothek.
Ausblick: Vorkehrungen für den Herbst
Frau Ravens-Sieberer, Herr Vilser hat eben schon den Blick kurz voraus gerichtet Richtung Herbst. Ich würde Sie beide gern zum Ende dieser Folge noch um einen solchen Ausblick bitten mit der Frage: Was muss aus Ihrer Perspektive für Ihr Forschungsfeld und Ihre Klientel sozusagen jetzt getan werden als Vorsorge für einen möglichen weiteren Pandemiewinter?
Ravens-Sieberer: Ich glaube, dass wir hier sozusagen besser aufgestellt sind, als dass sich alle Fachgesellschaften und auch der Expertenrat dafür ausgesprochen haben, dass die Schulen offen bleiben sollen. Und ich glaube, das sollten wir auch versuchen. Wir haben eben gesehen, dass am Anfang der Pandemie, als wir den Lockdown hatten, da hatten wir nicht wirklich im Blick, was das für Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen hinsichtlich ihrer Befindlichkeit haben kann.
Also ich finde, wir haben das als Gesellschaft bisher nicht so gut geschafft, die psychische Gesundheit der Kinder im Verlauf der Pandemie zu verbessern oder auch nur zu stabilisieren. Sie hat sich halt in vielen Punkten im Vergleich zu vor der Pandemie weiter verschlechtert. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass die Schulen offen bleiben, dass die S3-Leitlinie zu den Maßnahmen in den Schulen gut umgesetzt wird.
Und wir brauchen dafür einheitliche Strukturen, damit alle letztendlich die gleichen Chancen haben. Also ich glaube, dass wir noch viel tun können, was die Konzepte für den Distanzunterricht angehen und sozusagen der Frage, was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Kind nicht zur Schule gehen kann? Wie können wir den Kontakt halten? Und ich glaube auch, dass wir noch deutlich mehr die Lehrer und auch das pädagogische Personal schulen sollen. Wann erkennt man eigentlich früh, ob ein Kind oder Jugendlicher unter der Situation leidet, gerade bei den Kindern aus Risikogruppen?
Also sozusagen diese Kette von Erkennen, da liegt etwas im Argen, hin zu Unterstützungssystemen, die ist für mich irgendwie noch nicht wirklich so gut geschlossen. Ich glaube, da können wir noch viel tun. Ich denke, die Schulen werden gebraucht, so als Ort der Wertschätzung für Struktur und Teilhabe und für soziale Kontakte. Und ich glaube auch, dass wir mit einem guten Hygienekonzept, also mit Testung und Abstand und Masken die Schulöffnung weiterhin möglich ist.
So wird es ja auch empfohlen. Und wenn zwischendurch Wechselunterricht sein muss, weil das jetzt sozusagen die Pandemie erfordert, oder Kleingruppen, dann brauchen wir da, glaube ich, einfach noch gute Konzepte, wie wir das konkret umsetzen, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben.
Hennig: Sie haben die S3-Leitlinie angesprochen, da sind die Fachgesellschaften alle dabei gewesen. Das ist sehr detailliert auf über 100 Seiten aufgeführt, was alles getan werden kann und in welcher Phase. Sie selber waren auch Mitautorin der Leopoldina-Stellungnahme zu Kindern in der Pandemie. Das sind ja Grundprobleme des Schulsystems, die auch vor der Pandemie bestanden haben, die Sie jetzt angesprochen haben.
Und manchmal scheitert dann Distanzunterricht auch immer noch an technischen Voraussetzungen, kein ausreichendes Internet in den Schulen. Sie haben das jetzt so diplomatisch formuliert "wir brauchen mehr Konzepte". Wenn Sie jetzt aber konkret draufgucken und ich Sie mal ganz hart daraufhin frage: Ist denn da wirklich genug passiert? Sehen Sie das?
Ravens-Sieberer: Ja, meine Sorge ist groß, dass nicht genug passiert ist. Meine Sorge ist groß, dass wir in den Herbst und Winter reingehen und uns im Grunde genommen wieder überrascht fühlen. Und ich finde, das darf nicht sein. Also ich finde, jetzt im nächsten Herbst kann keiner mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Deswegen glaube ich, was wir im Moment tun, ist diese S3-Leitlinie innerhalb des Netzwerkes Universitätsmedizin in einem großen Projekt, das "Covered Child" heißt und sich sozusagen mit den langfristigen Auswirkungen der Pandemie bei Kindern beschäftigt, zu überarbeiten und zu aktualisieren, sodass wir darauf vorbereitet sind, im Herbst eventuell die Empfehlungen anpassen zu können.
Das ist viel Kleinarbeit, weil man noch mal die ganze Evidenz zusammensammeln muss. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach wichtig, dass alle Akteure darauf achten, dass sich da etwas tut. Und das kann ich im Moment, mag sein, dass ich es nicht erkenne, weil ich nicht nah genug dran bin, aber ich kann im Moment nicht erkennen, dass wir gut aufgestellt wären. Sollten wir noch mal vor der Situation stehen, dass wir eine andere Variante bekommen und die Inzidenzen hochgehen und wir noch mal Kontaktbeschränkungen erlassen müssen, dann kann ich im Moment nicht sehen, dass sich so wahnsinnig viel ändert.
Situation der Eltern
Und ich kann auch nicht sehen, das ist auch ein Punkt, über den haben wir heute gar nicht gesprochen, der liegt mir aber auch sehr am Herzen, dass die Eltern dann auch wieder entlastet werden. Denn wir haben gesehen, die haben wirklich alles versucht, um das gut zu machen, aber unter großen Anstrengungen.
Und ich glaube, wir müssen auch hier den Familien, also nicht nur den Kindern und Jugendlichen selber, sondern auch den Familien viel Unterstützung geben und sozusagen auch mit denen in Kontakt bleiben und Hilfestellungen geben. Nicht nur Homeschooling, sondern auch generell, wie eigentlich mit einer solchen Situation in der Familie umgegangen werden kann. Damit sie letztendlich diese Stabilität der Kinder auch mit befördern können.
Und das haben wir in der letzten Zeit der Pandemie eigentlich nicht so gut hinbekommen. Wir wissen ja auch, dass Beratungsstellen überfordert sind. Lange Wartelisten haben und auch alle Versorgungsplätze eigentlich mittlerweile ausgebucht sind. Ich glaube, da muss man wirklich mit staatlichen Strukturen noch mal deutlicher nachsteuern.
Psychosoziale und medizinische Versorgungslage in Deutschland
Hennig: Da sprechen Sie ja auch Anlaufstellen an und wenn wir noch einmal zurückkehren zur COPSY-Studie und den Zahlen, die Sie da erhoben haben, wenn aus psychischen Auffälligkeiten dann richtige Erkrankungen werden: Wie steht es da momentan um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Sind da endlose Wartezeiten für Therapien?
Ravens-Sieberer: Genau. Erst mal möchte ich noch mal vorausschicken, wir haben natürlich die Auffälligkeiten erfasst. Aber wir wissen nicht, ob das wirklich Erkrankungen werden.
Hennig: Aber sie haben das Risiko ja ausgemessen.
Ravens-Sieberer: Das Risiko ist sozusagen erhöht, dennoch muss es immer gut abgeklärt werden. Das ist natürlich wichtig. Im Moment sehen wir, dass Kinderpsychiatrische-Ambulanzen, Kinder- und Jugendpsychiater, aber auch niedrigschwellige Chat- und auch Telefonangebote einen immensen Bedarf haben und die Wartelisten wirklich lang sind.
Und wir haben ja gesagt, die Zahlen sind sozusagen nach dem Sommer gesunken. Also wir sehen eine leichte Erholung, aber trotzdem schieben wir halt so eine Welle des Bedarfs vor uns her, an psychiatrischer und psychologischer Versorgung bei den Kindern und Jugendlichen. Das hat natürlich verschiedene Gründe, denn das tritt ja zeitverzögert auf. Und wir sehen natürlich, der erhöhte Bedarf ist überall gleichzeitig. Weil in der Pandemie alle gleichzeitig belastet sind, sorgt das für erhöhte psychische und psychosomatische Probleme, die dann eben auch alle abgeklärt werden wollen.
Und wir wussten ja schon vor der Pandemie, dass es sozusagen zu wenig Anlaufstellen gibt für psychische Belastungen. Und das hat sich jetzt noch mal verstärkt unter der Pandemie. Und ich glaube, da ist ganz akuter Handlungsbedarf.
Hennig: Herr Vilser, Anlaufstellen und Versorgung, das war am Rande immer mal wieder Thema mit Blick zum Beispiel auf Kinderintensivstationen. Das läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Aber da sagen dann Intensivmediziner, die sind schon immer sehr auf Kante genäht und kommen schnell an ihre Grenzen. Wie steht es denn um die Versorgung zum Beispiel auch für langfristige Folgen des Virus? So eine Ambulanz, wie Sie sie in Jena haben. Sind wir da schon gut aufgestellt?
Medizinische Versorgung von Kindern
Vilser: Na ja, wenn das Thema auf Versorgung, medizinischer Versorgung von Kindern und Jugendlichen kommt, da weiß ich nicht, ob ich heulen oder brechen soll, weil es in den letzten Jahren so konsequent kaputtgespart wurde. Frau Ravens-Sieberer hat gerade schon gesagt, wie das bei den psychischen Erkrankungen ist. Das ist bei den somatischen eins zu eins genauso zu sehen.
Das heißt, wir steuern wirklich hart auf eine Minderversorgung zu, und zwar in allen Bereichen, sowohl bei den ambulant niedergelassenen Kinderärzten als auch ganz schlimm vor allen Dingen bei den Kliniken und die Intensivstation. Es werden in Deutschland reihenweise Intensivstationen geschlossen oder die Betten auf die Hälfte reduziert, weil kein Personal mehr da ist, weil es eben nicht finanziert wird. Und ich finde immer, man merkt an diesen Punkten ganz extrem, was Politikern wichtig ist.
Und offensichtlich ist eine Patientengruppe, die nicht wählen kann, auch nicht wichtig. So kommt es zumindest bei mir an. Jetzt haben wir auf dieses noch nicht komplett kaputtgesparte, aber doch sehr zusammengestauchte System eine Pandemie. Wenn die Kinder davon ansatzweise so betroffen gewesen wären wie die Erwachsenen, dann wären wir krachen gegangen. Das hätten wir nicht handeln können. Keine Chance. Dann wären die Kinder gestorben wie die Fliegen.
Da ist jetzt auch ein bisschen ein bisschen Dramatik drin. Aber wir sind einfach nicht gut genug ausgestattet, die Pandemie und auch jetzt die Folgen der Pandemie wirklich so zu handeln, wie wir es sollten. Und ein vereintes Zentrum an einzelnen Universitäten zur Behandlung dieser Folgen bei 50.000 Kinder, das ist lächerlich. Wir haben Wartezeiten von Wochen und Monaten. Ich bin nur dabei, per Mail und Telefon Patienten zu vertrösten oder das irgendwie zu versuchen es telefonisch hinzubekommen. Also Sie merken schon, da werde ich fast emotional, weil es wirklich nervt. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Kinder besser versorgt sind.
Hennig: Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft. Das Medizinische, das Gesundheitssystem, da ist viel drüber gesprochen worden in der Pandemie. Also noch mal, Sie sagen, bei Kindern ist es noch viel dramatischer?
Vilser: Ja, also aus meiner Sicht ist das ein Ungleichgewicht. Das hat, glaube ich, wesentlich mit der Vergütung zu tun und natürlich mit den Reizen, die ich für eine Versorgung setze. Mittlerweile sitzt in Krankenhäusern ganz oben in der Regel jemand, der die Ökonomie im Auge hat.
Und wenn der eine Abteilung sieht, die permanent Miese schreibt, dann versucht er, die entweder zusammen zu kürzen oder zumindest nicht weiter zu stärken. Und wenn man das über Jahrzehnte so macht, dann führt das eben dazu, dass das irgendwann nicht mehr kompensierbar ist mit reinem Enthusiasmus, den wir sicherlich als Kinderärzte alle haben.
Link-Sammlung aller erwähnten Studien in der Sonderfolge
Podcast Empfehlungen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Coronavirus