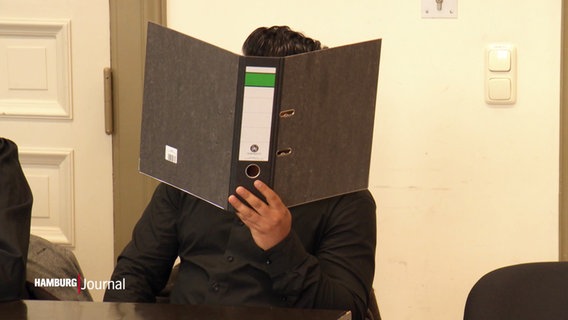NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Auch SPD stimmt für schwarz-roten Koalitionsvertrag
Der geplanten schwarz-roten Bundesregierung steht nichts mehr im Weg. Nach CSU und CDU haben auch die SPD-Mitglieder für den ausgehandelten Koalitionsvertrag der drei Parteien gestimmt. Laut SPD-Generalsekretär Miersch lag die Zustimmung in der Befragung bei knapp 85 Prozent. 56 Prozent der Mitglieder haben sich demnach beteiligt. Am kommenden Montag wollen die Sozialdemokraten bekannt geben, wer welchen Ministerposten erhält. Klar ist schon, dass der Co-Vorsitzende Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler werden soll. Als wahrscheinlich gilt außerdem, dass Verteidigungsminister Pistorius im Amt bleibt. Am Dienstag soll CDU-Chef Merz im Bundestag dann zum Kanzler gewählt werden.
Link zu dieser MeldungRegierung Scholz geht mit Rentenerhöhung
Während sich in Berlin die neue Regierung formiert, ist die alte zu ihrer vermutlich letzten Kabinettssitzung zusammengekommen. Dabei haben SPD und Grüne die geplante Rentenerhöhung auf den Weg gebracht. Für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gibt es ab Juli deutlich mehr Geld. Bundesweit steigen die Bezüge im Schnitt um gut 3,7 Prozent. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet das 66 Euro mehr im Monat. Es ist heute voraussichtlich das letzte Mal, dass Kanzler Scholz eine Kabinettssitzung leitet. Danach reist er zu einem Abschiedsbesuch zum französischen Präsidenten Macron nach Paris.
Link zu dieser MeldungBilligere Energie: Inflation sinkt erneut
Die Inflationsrate in Deutschland ist den zweiten Monat in Folge gesunken. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,1 Prozent. Im März lag der Wert leicht darüber. Nach Angaben der Statistiker ist vor allem Energie billiger geworden. Allerdings sind die Preise in Deutschland - verglichen mit der Zeit vor Beginn des Ukraine-Kriegs - auf relativ hohem Niveau.
Link zu dieser MeldungArbeitsmarkt: Frühjahrsbelebung weiter relativ schwach
Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Zwar ging die Zahl der Arbeitslosen im April laut Arbeitsagentur im Vergleich zum März leicht zurück - auf insgesamt 2,93 Millionen. Verglichen mit dem April des vergangenen Jahres sind allerdings mehr Menschen arbeitslos - und zwar etwa 180.000. Damit fällt die Frühjahrsbelebung weiter relativ schwach aus. Normalerweise erlebt der Arbeitsmarkt ab März einen Aufschwung. In wetteranfälligen Branchen - wie dem Bau - wird dann wieder mehr gearbeitet.
Link zu dieser MeldungIsraelisches Militär: Druck auf Hamas wird erhöht
Das israelische Militär plant offenbar, die Einsätze im Gaza-Streifen weiter auszuweiten. Medien berichten, dass zehntausende zusätzliche Reservisten einberufen werden sollen - damit Wehrpflichtige etwa aus dem Libanon oder aus Syrien nach Gaza verlegt werden könnten. Die Armee kündigte bereits an, den Druck auf die Hamas in Gaza zu erhöhen. So sollen die Islamisten dazu gebracht werden, wieder über die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu verhandeln. Gleichzeitig gibt es weiter Berichte über schwere Kämpfe im Gaza-Streifen. Nach palästinensischen Angaben sollen allein in den vergangenen Stunden mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Augenzeugen berichten von willkürlichem Beschuss.
Link zu dieser MeldungKirchentag in Hannover beginnt
Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel und einem Straßenfest beginnt in Hannover der Evangelische Kirchentag. Bis Sonntag sind rund 1.500 Veranstaltungen zu Glaubensfragen und gesellschaftlichen Themen wie Frieden, Klimaschutz und Rechtsextremismus geplant. In der Innenstadt von Hannover gibt es kostenlose Konzerte von Künstlern wie Max Herre, Joy Denalane und Jupiter Jones. Die Polizei rechnet mit bis zu 150.000 Besuchern täglich. Zum Auftakt des Kirchentags wird Bundespräsident Steinmeier erwartet. Außerdem haben sich Kanzler Scholz, Altkanzlerin Merkel und Bundestagspräsidentin Klöckner angekündigt.
Link zu dieser Meldung"Sommermärchen": Verfahren gegen Ex-DFB-Präsident Zwanziger eingestellt
Im sogenannte Sommermärchen-Prozess ist das Verfahren gegen den früheren DFB-Präsidenten Zwanziger eingestellt worden. Sowohl der 79-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft stimmte dem Vorschlag des Frankfurter Landgerichts zu, dass Zwanziger eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro zahlt. In dem Prozess geht es um mutmaßliche Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen bei der WM-Vergabe 2006. Anstelle von Zwanziger wird der Prozess jetzt gegen den DFB fortgesetzt.
Link zu dieser MeldungWolfsburg-Frauen holen neuen Trainer
Die Fußballerinnen des Vfl Wolfsburg bekommen Stephan Lerch als Trainer zurück. Das hat der Verein nun offiziell bestätigt. Lerch hatte die Bundesligamannschaft schon einmal trainiert. Zwischen 2017 und 2021 gewann der 40-Jährige mit dem VfL dreimal die deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. Lerch löst Tommy Stroot ab. Er war im April überraschend zurückgetreten - mit der Begründung, er habe keine Energie mehr für den Job.
Link zu dieser MeldungDas Wetter in Norddeutschland
Viel Sonne, nur stellenweise Wolken und verbreitet trocken. 20 bis 25 Grad, an der See 15 bis 20 Grad. In der Nacht locker bewölkt bis klar und trocken bei 10 bis 5 Grad. Morgen nach Frühnebel oft heiter oder sonnig uund trocken. 22 bis 28 Grad, an der See 17 bis 21 Grad. Am Freitag bei Sonne und Wolken gebietsweise Schauer, dazu 14 bis 26 Grad. Am Sonnabend heiter bis wolkig, gebietsweise Schauer, 13 bis 20 Grad.
Link zu dieser Meldung