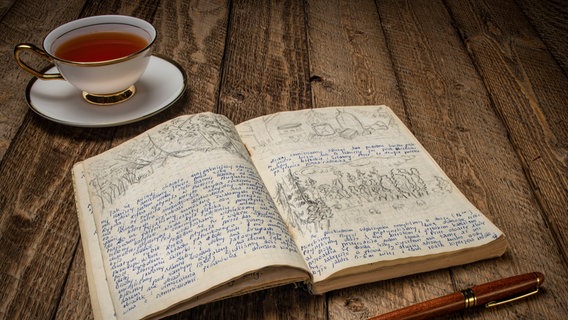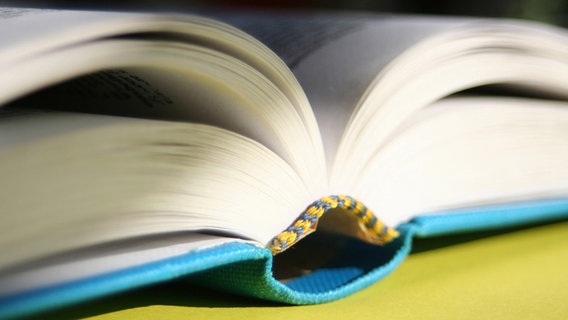De ne'e Regeren in Hamborg steiht. To't drütte Mal is Peter Tschentscher to'n 'Eersten Börgermeester wählt worrn. All 70 Afornten vun SPD un Gröne weern bi de Wahl dor. Tschentscher kreeg in geheeme Aftimmen gors 71 Stimmen, also minnst een ut de Oppositschoon. Dorna hett de Börgerschop de ne'en Senaters un Senaterschen bestätigt. De hele Senat kreeg blots 68 Stimmen. Dor geev dat also minnst twee, de dor afweken sünd. En ne'et Gesicht is Maryam Blumenthal. De Co-Parteivörsittersch vun de Hamborger Grönen is nu Wetenschopsenatersch.
Dat is akkraat 80 Johr her, dor hett de Twete Weltkrieg sien Enn funnen. Un Düütschland besinnt sik dorop. Hier in Hamborg fangt de zentrale Gedenkveranstalten op den Ohlsdörper Freedhoff an. Dor warrt sünnerlich de brit'schen Suldaten ehrt, de vör 80 Johr Hamborg un den Noorden in Düütschland besett hebbt. Se hebbt dusende vun Minschen ut Arbeitslagers, Kunzentratschoonslagers un Gefängnissen befreet.
Dor deit sik ganz schön wat, op den Immobilienmarkt in Hamborg. In't verleden Johr hebbt se 9.100 Immobilien verköfft. Dormit hebbt meist dörtig Perzent mehr Wahnen un Hüüs jemehr Besitters wesselt. Dat kann een ut den "Immobilienmarktbericht Hamborg" vun de Behöörd rutlesen. Man an de Priesen hett sik meist gor nix ännert. För Wahnen, de se nee boot hebbt, mutt een 8.200 Euro den Quadraatmeter betahlen. Un Een- un Tweefamilienhüüs köst in'n Snitt 560.000 Euro.
Spazeergängers hebbt an’n fröhen Avend in de Fischbeker Heid Knakens funnen, de woll vun en Minschen stammt. Jemehr Hunnen harrn opmal anslaan. De Besitters hebbt de Polizei ropen. De hett blangen de Knakens ok noch Resten vun Kledaasch un en Rucksack funnen. Se hebbt de Gegend dor wietlöfftig afsparrt. Bet nu weet een noch nich, wo lang de Överresten dor al legen hebbt un wat dor woll en Verbreken dorachter sticken deit.
In Bramfeld is in de Nacht en Geldautomat sprengt worrn. Lüüd, de dor in de Ne'egde wahnt, hebbt kort na Klock dree en luden Knall höört un de Polizei ropen. Opgliek se op de Steed anfungen hebbt, na jem to söken, kunnen se de Däders noch nich finnen. De sünd mit Boorgeld ut den Automaten flücht. Woveel se dorbi ruthaalt hebbt, weet een noch nich. De Fabriciusstraat weer för den Polizeiinsatz op Höögde vun'n Teerosenweg noch bet in den fröhen Morgen sparrt.
De Countdown löppt. Morgen geiht wedder de Hamborger Havengeburtsdag los. Kort tovör is ok wedder de Naturschulbund NABU an't Kritteln. Siet Johrn klaagt he över de slechte Luft un will innovative Krüüzfohrtscheep mit schoonlich Afgastechnik na Hamborg inladen. Un statt dat Füerwark, wat dat jümmer geven deit, sleit de NABU en Drohnen - un Lasershow vör.
Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af un dat blifft de mehrste Tiet dröög bi bet to 18 Graad.
Morgen süht dat meist jüst so ut, kann aver en Stück warmer warrn. De Temperaturen köönt dat noch op bet to 19 Graad schaffen.