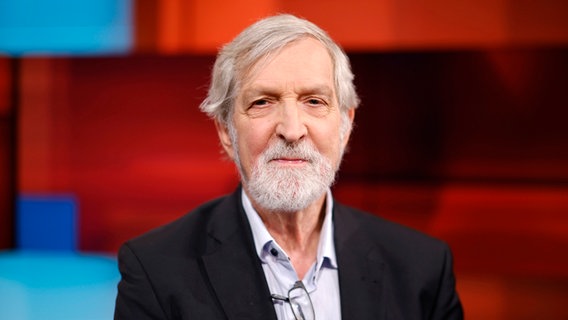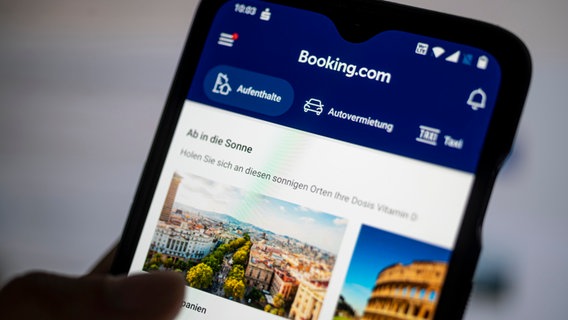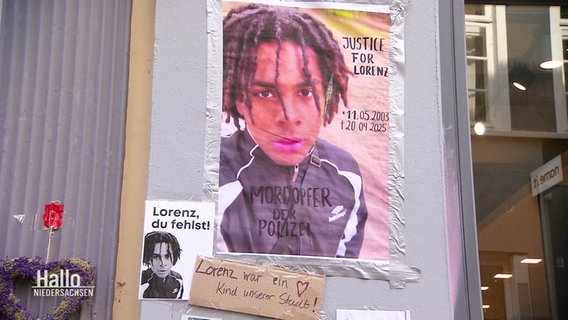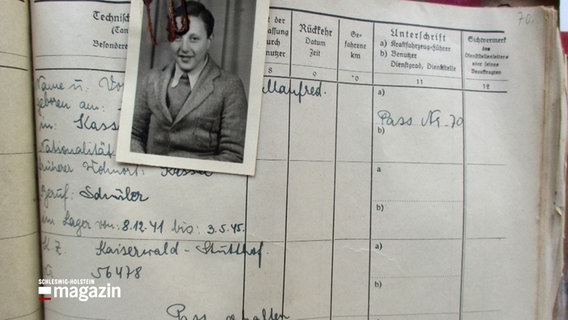NDR Info im Radio
MELDUNGEN
Bas und Klingbeil sollen SPD führen
Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen künftig gemeinsam die SPD führen. Die Arbeitsministerin kündigte an, beim Bundesparteitag Ende Juni für das Amt der Co-Vorsitzenden zu kandidieren. Sie habe dafür die Unterstützung von SPD-Präsidium und Vorstand. Der Co-Vorsitzende Klingbeil sagte, er wolle erneut kandidieren und gemeinsam mit Bas die Doppelspitze bilden. Neuer SPD-Generalsekretär soll der Schleswig-Holsteiner Tim Klüssendorf werden.
Link zu dieser MeldungSteinmeier fordert Hilfe für Gaza-Streifen
Bundespräsident Steinmeier hat Israel aufgefordert, Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen zuzulassen. Steinmeier sagte bei einem Treffen mit Israels Präsident Herzog, die Blockade für Hilfsgüter müsse aufgehoben werden - nicht irgendwann, sondern jetzt. Gleichzeitig sprach Steinmeier von einem Dilemma für Israel, das er verstehe: Die Terrororganisation Hamas verstecke sich hinter Zivilisten und bereichere sich an Hilfsgütern. Herzog war nach Berlin gekommen, um 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland zu feiern.
Link zu dieser MeldungHamas lässt amerikanisch-israelische Geisel frei
Die islamistische Hamas hat offenbar eine amerikanisch-israelische Geisel freigelassen. Israelische Medien berichten übereinstimmend, dass der 21-jährige Edan Alexander im Gaza-Streifen an das Rote Kreuz übergeben wurde. Hintergrund ist demnach eine Vereinbarung zwischen der Hamas und den USA - ohne israelische Beteiligung. Alexander war bei dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt worden.
Link zu dieser MeldungEU begrüßt amerikanisch-chinesische Einigung
Die Europäische Union hat den Abbau von Zöllen zwischen den USA und China begrüßt. Die EU-Kommission sprach von einem positiven Signal. Aus Sicht der EU sei alles gut, was zum reibungslosen Funktionieren globaler Lieferketten beitrage. Die USA und China hatten sich darauf geeinigt, die zuletzt drastisch gestiegenen wechselseitigen Zölle für die Dauer von 90 Tagen deutlich zu verringern. In dieser Zeit soll es weitere Gespräche geben.
Link zu dieser MeldungSelenskyj: Würde Trump-Teilnahme bei Istanbul+Treffen begrüßen
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine mögliche Teilnahme von US-Präsident Trump an Gesprächen mit Russland in der Türkei begrüßt. Dies sei die richtige Idee, erklärte Selenskyj. Er appellierte an den russischen Staatschef Putin, einem persönlichen Treffen nicht auszuweichen. Trump erwägt nach eigenen Worten, bei dem für Donnerstag in Istanbul geplanten Gespräch dabei zu sein. Putin hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er dort selbst Selenskyj treffen wird.
Link zu dieser MeldungGroßbritannien verschärft Migrationspolitik
Die britische Regierung hat eine Umkehr in der Migrationspolitik des Landes angekündigt. Premierminister Starmer sprach von der Politik der offenen Grenzen als einem gescheiterten Experiment. Dieses werde jetzt beendet. Konkret soll es weniger Visa für gering qualifizierte Arbeitnehmer, höhere Gehaltsanforderungen für ausländische Fachkräfte und höhere Mindeststandards bei den Englischkenntnisse von Migranten geben. Arbeitgeber sollen stärker auf die Qualifikation von britischen Arbeitskräften setzen.
Link zu dieser MeldungNadja Abd el Farrag gestorben
Die unter anderem als Fernsehmoderatorin bekannt gewordene Nadja Abd el Farrag ist tot. Sie starb übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits am Freitag im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik. Abd el Farrag hatte vor einigen Jahren selbst öffentlich gemacht, an einer Leberzirrhose zu leiden. Sie war in den 1990er Jahren als mehrjährige Partnerin von Musikproduzent Dieter Bohlen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Später präsentierte sie beim Fernsehsender RTL die Erotiksendung "Peep!" und nahm an TV-Formaten wie "Dschungelcamp" und "Big Brother" teil.
Link zu dieser MeldungDas Wetter in Norddeutschland
In der Nacht meist klar, Tiefstwerte plus 9 Grad auf Sylt und bis minus 1 Grad in Tribsees. Morgen oft sonnig und trocken, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag heiter bis wolkig bei 15 bis 23 Grad.
Link zu dieser Meldung