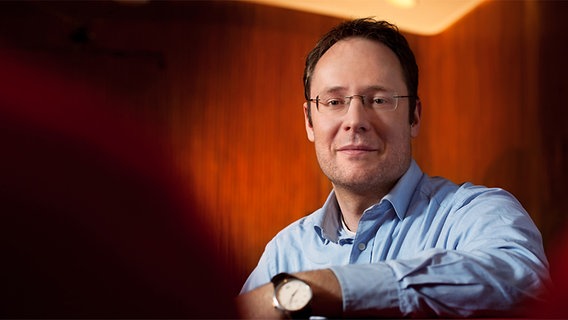Die NDR Info Kommentare
NDR Info berichtet nicht nur über die nationale und internationale Nachrichtenlage. Redakteure und Korrespondenten geben auch ihre jeweilige Meinung zu einzelnen aktuellen Themen ab und schätzen Sachverhalte aus ihrer Sicht ein. Die Kommentare aus dem NDR Info Programm finden Sie hier zum Nachlesen.