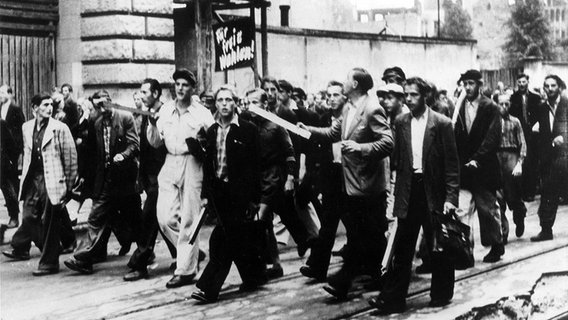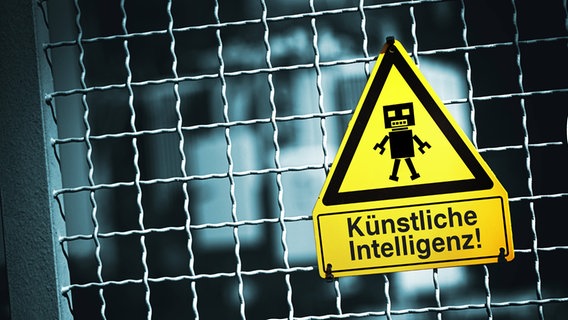Gedanken zur Zeit

Die Essay-Reihe „Gedanken zur Zeit“ endet mit der Ausgabe vom 8.7.2023. Die Texte der vergangenen Monate können Sie hier noch einmal nachlesen. Es sind Beiträge zur geistigen Situation der Zeit - und gelegentlich auch zum Zeitgeist. Die Texte geben Orientierung in einer unübersichtlichen Gegenwart. "Gedanken zur Zeit" ist eine Reihe mit großer Tradition. Peter von Zahn und Axel Eggebrecht waren die "Erfinder.
Vertiefenden Diskurs und inspirierende Auseinandersetzung mit großen Fragen der Zeit, des Mensch-Seins und des Zusammenlebens finden Sie auch künftig bei NDR Kultur: Unser Philosophie-Podcast „Tee mit Warum“ nimmt den Faden des Nachdenkens auf, in lebendig-dialogischer Form, im Gespräch mit Philosophinnen und Philosophen – und im Austausch mit Menschen, die in Beruf und Alltag mit den großen Fragen in Berührung kommen, die uns alle betreffen.